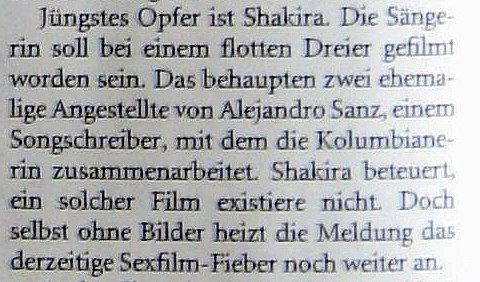Bob Dylan hat viele entscheidende Fragen gestellt: Wie viele Straßen muss ein Mann entlanggehen, bis man ihn einen Mann heißen darf? Wie viele Meere muss eine weiße Taube überfliegen, bevor sie im Sand schläft? Wie lang kann ein Berg existieren, bis er ins Meer erodiert ist? Und auch, wenn die Antwort eh irgendwo im Wind weht, fehlt eine entscheidende Frage (die 1963 freilich schwer progressiv bis völlig unverständlich gewesen wäre): Wie oft muss man eine Freundschaftsanfrage bei Facebook ablehnen, bevor der Anfragende endlich versteht?
Facebook ist vermutlich jetzt schon das wichtigste Ding seit Erfindung des World Wide Web. Es ersetzt das eigene Telefonbuch (oder übernimmt es einfach), ist Kontaktverzeichnis und ‑börse zugleich, darüber hinaus Raucherecke, Spielplatz, Veranstaltungskalender und was nicht noch alles. Außerdem hat es eine besorgniserregende Macht und – wie jedes ordentliche Computerunternehmen – einen nicht weniger besorgniserregenden Chef. (David Fincher hat gerade einen Film über Mark Zuckerberg gedreht – das macht er sonst nur bei Serienmördern, Psychopathen und Menschen, die immer jünger werden.)
Nichtsdestotrotz ist Facebook auch ein wichtiger Bestandteil meines Leben, wobei man nie vergessen darf, dass es nicht das Leben ist (zur Unterscheidung: Facebook ist das, wo man sich ein paar Stunden Zeit lassen kann, um schlagfertig zu sein). Und während manche Leute das alte MySpace-Prinzip (für die Jüngeren: MySpace war 2006 halb so wichtig wie Facebook heute) weiterverfolgen, das eigentlich ein Panini- oder Pokemon-Prinzip ist und „Krieg‘ sie alle!“ lautet, dürften die Meisten Facebook doch eher als die Summe aller bisher angehäuften Freundeskreise nutzen, angereichert um einige lose Bekannte und Verwandte und um Leute, die einem noch mal wichtig sein könnten.
Ich achte ziemlich genau darauf, wen ich bei Facebook als „Freund“ hinzufüge, und auch wenn ich mich wohl von meinem Plan verabschieden muss, nie mehr als 222 Kontakte zu haben, ist es doch ein einigermaßen elitärer Haufen. Alle paar Monate gehe ich mit der Heckenschere durch meine Kontaktliste und entrümpel sie von Karteileichen und Leuten, die schlichtweg – Verzeihung! – nerven. Ich halte es nur für höflich, bei Freundschaftsanfragen, die nicht völlig offensichtlich sind („Luke, ich bin Dein Vater!“), kurz hinzuzufügen, woher man sich kennen könnte bzw. sollte. Menschen, die mit einem ähnlich selektiven Namens- und Gesichtsgedächtnis geschlagen sind wie ich, freuen sich über derlei Hinweise. Andererseits gilt es auch zu akzeptieren, wenn eine Freundschaftsanfrage ignoriert oder abschlägig beschieden wird – womit wir wieder bei Bob Dylan wären. Selbst die Funktion „I don’t even know this person“ scheint nicht zu verhindern, Minuten später schon wieder von den gleichen Massenbefreundern angefragt zu werden, deren Verhältnis zu einem selbst sich auch nach minutenlangem Googeln nicht erschließt.
Und dann ist da noch etwas: What happens in Facebook stays in Facebook.
Menschen, die via Twitter eine nicht näher definierte Zielgruppe über Abendplanung, Arbeitgeber und Unterleibsbeschwerden informieren, mögen es unverständlich finden, aber bei Facebook spreche ich zu einem klar umrissenen Publikum – für uneingeschränkt öffentliche Verlautbarungen habe ich ja immer noch dieses Blog. In meinem Facebook-Account wird sich nichts finden, was streng privat oder gar intim ist, aber es handelt sich dabei dennoch um classified information. Das ist ein Vertrauensvorschuss an meine Facebook-Kontakte und wer mein Vertrauen missbraucht, wird hart bestraft. (Na ja: So hart, wie es das Gesetz gerade noch zulässt. Ich hab ja auch keine Lust, mich vor dem UNO-Tribunal zu verantworten.)
Gab’s sonst noch was? Ach ja: Bitte denken Sie ein paar Sekunden nach, bevor Sie mich zu irgendwelchen Veranstaltungen oder in irgendwelche Gruppen einladen wollen.
PS: Die Deutschlandfähnchen auf den Benutzerbildern könnten dann auch mal langsam weg. Es ist vorbei!