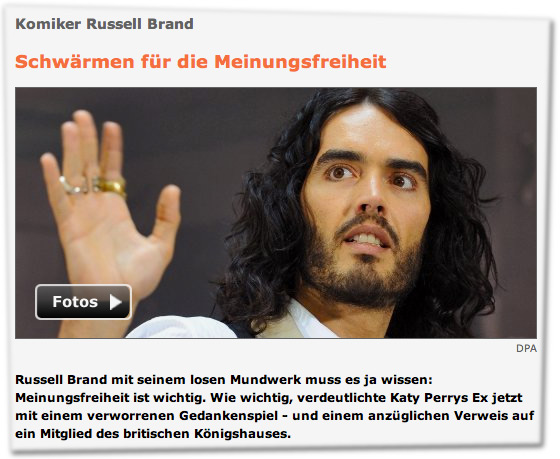Wenn sich der Mann, der in der Nacht zum Freitag in einem Kino in Colorado 12 Menschen erschossen und 58 weitere verletzt hat, für eine andere Vorstellung entschieden hätte, wäre alles anders: „Ice Age 4“, der Katy-Perry-Konzertfilm, schon „The Amazing Spider-Man“ hätte alles geändert, aber der Mann ging in die Mitternachtsvorstellung von „The Dark Knight Rises“ – ob gezielt, ist noch nicht klar.
dapd schreibt:
Der Polizeichef von New York, Raymond Kelly, sagte, der Verdächtige habe seine Haare rot gefärbt und gesagt, er sei der „Joker“, ein Bösewicht aus den „Batman“-Filmen und ‑Comicbüchern. „Das ist meines Wissens nach nicht wahr“, sagte hingegen der örtliche Polizeichef Dan Oates, erklärte aber mit Kelly gesprochen zu haben.
Der Polizeichef einer 2.800 Kilometer entfernten Stadt sagt etwas, was der örtliche Polizeichef nicht bestätigen kann oder will – das kann man aufschreiben, wenn man die ohnehin ins Kraut schießenden Spekulationen weiter anheizen will, muss es aber sicher nicht.
Das heißt: Als Nachrichtenagentur im Jahr 2012 muss man es wahrscheinlich schon, weil die Kunden, allen voran die Onlinedienste, ja sonst selbst anfangen müssten, irgendwelche mutmaßlichen Details aus dem Internet zusammenzutragen. Dabei gibt es kaum welche!
„Spiegel Online“ kommentiert den Umstand, dass der Mann offenbar nicht bei „Facebook, Twitter, irgendein Social Network herkömmlicher Strickart“ angemeldet war, dann auch entsprechend so:
Bei den Fahndern wirft das Fragen auf, während es bei jüngeren Internetnutzern für Fassungslosigkeit sorgt. Ihnen erscheint [der Täter] wie ein Geist. Wie kann das sein, dass ein 24 Jahre junger amerikanischer Akademiker nicht vernetzt ist? Mit niemandem kommuniziert, Bilder tauscht, Status-Aktualisierungen veröffentlicht, sich selbst öffentlich macht?
Man hätte es also wieder einmal kommen sehen müssen:
Dass [der Täter] im Web nicht präsent ist, macht ihn heute genauso verdächtig, wie er es als exzessiver Nutzer wäre. Im Januar 2011 veröffentlichte ein Team um den Jugendpsychologen Richard E. Bélanger eine Studie, die exzessive Internetnutzung genau wie Internet- und Vernetzungs-Abstinenz bei jungen Leuten zu einem Warnsignal für mentale Erkrankungen erklärte.
Erst an dieser Stelle, in den letzten Absätzen, wendet sich Autor Frank Patalong gegen die von ihm bisher referierten Thesen:
Man muss sich einmal vorstellen, was es für uns alle bedeuten würde, wenn das Konsens würde: Dann wäre nur noch der unverdächtig, der ein „normales“ Online-Verhalten zeigt, Selbstveröffentlichung per Social Network inklusive.
Doch vielleicht braucht man aus […] fehlender Online-Präsenz kein Mysterium zu machen. Vielleicht ist […] einfach nur ein ehemaliger Überflieger, der mit seinem eigenen Scheitern nicht zurechtkam. Ein Niemand, der jemand werden wollte, und sei es mit Gewalt auf Kosten unschuldiger Menschen.
Es gibt allerdings berechtigte Hoffnung darauf, dass die Talsohle bereits erreicht wurde – womöglich gar bis zum Ende des Jahres oder dem der Welt.
Beim Versuch, mögliche Zusammenhänge zwischen den „Batman“-Filmen und dem Massenmord im Kino als haltlose Spekulation zurückzuweisen, lehnt sich Hanns-Georg Rodek bei „Welt Online“ nämlich derart weit aus dem Fenster, dass er fast schon wieder im Nachbarhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite (vierspurige Straße mit Parkbuchten am Rand und Grünstreifen in der Mitte) ankommt.
Aber leider nur fast:
[Der Täter] flüchtete durch den Notausgang und wurde, ohne Widerstand zu leisten, bei seinem Auto gefasst. Dabei soll er „Ich bin der Joker, der Feind von Batman“ gesagt haben.
Daraus lässt sich eine erste wichtige Folgerung ziehen: Der Attentäter hat den Film nicht gesehen, auch nicht im Netz, weil dort keine Raubkopien kursierten, und er kann sich den Inhalt nur bruchstückhaft zusammengereimt haben, wobei allerdings Allgemeinwissen war, dass der Joker gar nicht auftritt.
Laut Rodek war der Joker also da, wo sich die Leser seines Artikels wähnen: im falschen Film. Er hätte nicht die erste Vorstellung von „The Dark Knight Rises“ stürmen müssen, sondern eine der (zum Start des Films zahlreich angebotenen) Wiederaufführungen des zweiten „Batman“-Films von Christopher Nolan, „The Dark Knight“. Denn da hätte ja der Joker mitgespielt.
Aber das ist eh alles egal, so Rodek:
Auf jeden Fall hätte [der Täter], wäre seine Stilisierung ernst gemeint gewesen, sich die Haare nicht rot färben müssen, sondern grün. Der Joker trägt grünes Haar, weil er einmal in ein Fass mit Chemikalien fiel, das weiß in Amerika jedes Kind.
Die Leute von dpa wussten es nicht, aber die sind ja auch keine amerikanischen Kinder. Und das, wo Rodek den Jugend- und Teenager-Begriff schon ausgesprochen weit fasst:
US-Teenager – [der Täter] ist 24 – wissen ziemlich gut über diese Figur Bescheid.
Rodek hingegen weiß über Massenmorde ziemlich gut Bescheid:
Das Century-Kino war die perfekte Bühne – Hunderte Menschen, zusammengepfercht, ihm in Dunkel und Gasnebel ausgeliefert. Ein Ort, besser noch für sein Vorhaben als eine Schule, ein Einkaufszentrum oder eine bewaldete Insel.
Ein Kino ist beim Amoklauf-Quartett also unschlagbar, quasi der … äh: Joker.
Viel kann man zum jetzigen Zeitpunkt aber eh noch nicht sagen:
Genaue Gründe für seine Mordlust werden die Psychologen erforschen, sie dürften irgendwo zwischen persönlicher Vereinsamung und der Unfähigkeit der Gesellschaft liegen, ihm trotz seiner anscheinenden Intelligenz mehr als einen McDonald’s‑Job zu bieten.
Das steckt natürlich ein weites Spektrum ab. Der Satz „Alles andere wäre zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation“ ist an dieser Stelle mutmaßlich dem Lektorat zum Opfer gefallen.
Tatsächlich geht es aber um etwas ganz anderes:
Sich mit allen Mitteln in Szene zu setzen, ist heute erste Bürgerpflicht, in der Schule, in der Clique, bei der Superstar-Vorauswahl, bei der Bewerbung um eine Arbeitsstelle. [Der Täter] hat diese Lektion hervorragend gelernt.
Er hat also nicht nur die „perfekte Bühne“ gewählt, sondern auch die Selbstdarstellungslektion „hervorragend gelernt“. Da ist es doch tatsächlich fraglich, warum so ein offenkundig brillanter Mann wie dieser Massenmörder bei McDonald’s arbeiten musste.
Gerade, wo er auch bei der Wahl des richtigen Kinofilms die richtige Entscheidung (gegen „Ice Age 4“, wir erinnern uns) getroffen hat:
Er hat den Abend der ersten Vorführung des meisterwarteten Films des Jahres gewählt (zwei Wochen später hätte er genauso viele umbringen können, nur der Aufmerksamkeitseffekt wäre geringer gewesen), und er hat sich das Label „Joker“ selbst verpasst, das die Medien von nun an verwenden werden.
Ja, manche menschliche Gehirne wären an dieser Stelle auf Notaus gegangen. Der Versuch zu erklären, warum der Täter nichts mit dem Joker zu tun hat (er hat ja offenbar nicht mal die Filme gesehen!), ist an dieser Stelle jedenfalls endgültig gescheitert. Selbst beim Anschreiben gegen den medialen Wahnsinn ist Rodek in eine der klassischen Fallen getappt, die solche Massenmörder gerne auslegen um darin schlagzeilengeile Journalisten im Rudel zu fangen: Die Medien begehen die finale Beihilfe zur Selbstinszenierung. Es ist also so wie immer.
„Spiegel Online“ hat das auch beeindruckend unglücklich hinbekommen: Der Artikel darüber, dass der Gouverneur von Colorado sich weigert, den Namen des Täters auszusprechen, und dass US-Präsident Obama sagte, später werde man sich nur an die Opfer, nicht aber an den Täter erinnern, beginnt mit dem Namen des Täters, der im weiteren Artikel noch ganze 21 Male vorkommt.
Doch zurück zu „Welt Online“, zum „Joker“, der nicht der Joker ist:
Wäre er wirklich auf merkwürdige Art vom Joker besessen, hätte er sich ihm auch nachkostümiert. Aber nein, er war „professionell“ eingekleidet, mit schusssicherer schwarzer Weste und Atemmaske, wie die gruseligen Gestalten der Sondereinsatzteams von Polizei und Armee. Vielleicht sollte man eher dort nach verhängnisvollen Vorbildern suchen.
Na, viel Spaß dabei!