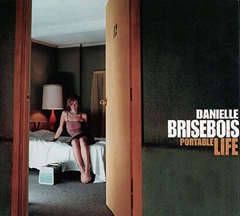Ich bin jetzt in einem Alter, in dem die meisten Menschen neue Musik nur noch über das Radio wahrnehmen. Beruf und Familie verhindern eine nähere Auseinandersetzung und man muss auch erkennen, dass das bei vielen Leuten eigentlich nie anders war: Die haben halt immer schon gehört, was in den Charts war oder was die Peer Group gehört hat – und das ist ja auch total okay, denn wenn sich alle Leute derart in Musik und Popkultur verlieren würden, käme ja niemand mehr zum Arbeiten und Kinder erziehen.
Obwohl ich mich bemühe, mit den allen aktuellen Veröffentlichungen mitzuhalten, höre ich dann doch meistens nur die neuen Alben der Künstler, die mich schon lange begleiten: Meine meistgehörten CDs im letzten Jahr waren die neuen von Weezer und Jimmy Eat World. Dieses Jahr habe ich mit Sampha und Stormzy immerhin schon zwei Debütalben gehört, aber aktuell auf hoher Rotation ist ein Künstler, der mich seit fast 15 Jahren begleitet: Andrew McMahon.
 Ich habe schon angesichts des ersten Andrew-McMahon-In-The-Wilderness-Albums versucht, das besondere Verhältnis zu beschreiben, dass ich zu ihm und seiner Musik – zuvor in den Bands Something Corporate und Jack’s Mannequin – habe. Andrew McMahon könnte auch ein Album voller Weather-Channel-Jingles veröffentlichen und ich würde es rauf und runter hören – was ganz praktisch ist, denn „Zombies On Broadway“ ist beinahe ein Album voller Weather-Channel-Jingles geworden.
Ich habe schon angesichts des ersten Andrew-McMahon-In-The-Wilderness-Albums versucht, das besondere Verhältnis zu beschreiben, dass ich zu ihm und seiner Musik – zuvor in den Bands Something Corporate und Jack’s Mannequin – habe. Andrew McMahon könnte auch ein Album voller Weather-Channel-Jingles veröffentlichen und ich würde es rauf und runter hören – was ganz praktisch ist, denn „Zombies On Broadway“ ist beinahe ein Album voller Weather-Channel-Jingles geworden.
Offenbar hat er viel mit seinen Kumpels von fun. rumgehangen, denn „Zombies“ setzt noch mehr auf großen, großen Pop als die Veröffentlichungen davor: Keyboardflächen, Chöre, programmierte Beats, viele Pauken (aber wenige Trompeten). Ungefähr jeder der zehn Songs auf dem Album klingt, als wolle sich Andrew McMahon als ESC-Komponist bewerben – im Positiven, wie im Negativen. Nur wenig erinnert noch an Something-Corporate-Kracher wie „Only Ashes“ oder „If You C Jordan“ oder einen Jack’s‑Mannequin-Song wie „The Mixed Tape“ (gut: da hat auch Tommy Lee getrommelt) – außer natürlich Andys Stimme (die über die Jahre deutlich sicherer und voller geworden ist), die unwiderstehlichen Melodien und die sanfte Melancholie, die in jedem Song irgendwo durchscheint.
Der Sprechgesang des Openers „Brooklyn, You’re Killing Me“ klopft bei Twenty One Pilots an, ohne deren Originalität und Vielseitigkeit zu erreichen. „Don’t Speak For Me“, dessen Intro gar an die schrecklichen Chainsmokers erinnert, war laut Andys Aussage ursprünglich für eine/n andere/n Künstler/In gedacht – und es ist angesichts des Sounds nicht ganz abwegig, dass das jemand wie Taylor Swift oder Selena Gomez hätten sein sollen (ohne jetzt irgendwas gegen die beiden sagen zu wollen). „Love And Great Buildings“ klingt nicht nur im Intro wie Owl City, sondern verläuft sich auch genauso zwischen den Bildspendern seiner Metaphern: „Love and great buildings will survive / Strong hearts and concrete stay alive / Through the great depressions / Yeah, the best things are designed to stand the test of time“. Ja, schon klar: das kann man unglaublich cheesy, schrecklich und schlimm finden, aber ich mag’s – aber ich mochte ja auch „Fireflies“.
Mein Highlight „So Close“ ist ein großartiges Liebeslied, das in den Strophen noch am ehesten an die alten Band-Sachen erinnert, um im Refrain dann irgendwo zwischen „Happy“ und „Can’t Stop The Feeling“ herumzutanzen, und die Vorabsingle „Fire Escape“ macht akustisch das große Fass der Chöre und Trommeln auf, das auf dem Album fast zum Überlaufen kommt.
Wie beim letzten Album gilt: Ich kann total verstehen, wenn man zu diesem Radiopop – der in den USA jetzt tatsächlich mal im Radio läuft – keinen Zugang findet und lieber zu Twenty One Pilots, Taylor Swift oder Owl City greift (die Chainsmokers bleiben natürlich indiskutabel). Und wenn man mit dem Alternative Rock von Something Corporate aufgewachsen ist, kostet es schon etwas Überwindung, diesen musikalischen Weg mitgehen zu wollen.
Andrew McMahon findet dazu wie immer die passenden Worte: „And these could be the best or darkest days / The lines we walk are paper thin / And we could pull this off or push away / Cause you and me have always been“ – um dann ganz oft die Worte „so close“ zu wiederholen.


 In Zeitschriften und Blogartikeln werden wir bombardiert mit Generationsbeschreibungen, Labels und Ansprüchen, von denen wir uns gleichzeitig ganz schnell frei machen sollen. Unsere Frauen sollen Familie und Beruf nicht nur unter einen Hut kriegen, sondern das auch wollen — während sie dabei wie Hollywood-Stars und ganz natürlich ausschauen. Unsere Kinder sollen drei Fremdsprachen lernen, die verpassten Chancen von uns und unseren Eltern nachholen und sich dabei frei entfalten können. Und wir Männer sollen gleichzeitig einfühlsam, stark, sportlich und kreativ sein. Vor allem aber, immer wieder: „wir“, dieser lächerliche Fraternisierungsversuch von zehntausenden Ertrinkenden, die sich aneinander klammern. Mit Gefühlen, die irgendwelche Slam-Poetinnen in (geborgte) Worte fassen, woraufhin dann alle anderthalb Tage sehr emo sind, bis Jan Böhmermann eine Parodie darauf veröffentlicht und alle wieder total ironisch sein können.
In Zeitschriften und Blogartikeln werden wir bombardiert mit Generationsbeschreibungen, Labels und Ansprüchen, von denen wir uns gleichzeitig ganz schnell frei machen sollen. Unsere Frauen sollen Familie und Beruf nicht nur unter einen Hut kriegen, sondern das auch wollen — während sie dabei wie Hollywood-Stars und ganz natürlich ausschauen. Unsere Kinder sollen drei Fremdsprachen lernen, die verpassten Chancen von uns und unseren Eltern nachholen und sich dabei frei entfalten können. Und wir Männer sollen gleichzeitig einfühlsam, stark, sportlich und kreativ sein. Vor allem aber, immer wieder: „wir“, dieser lächerliche Fraternisierungsversuch von zehntausenden Ertrinkenden, die sich aneinander klammern. Mit Gefühlen, die irgendwelche Slam-Poetinnen in (geborgte) Worte fassen, woraufhin dann alle anderthalb Tage sehr emo sind, bis Jan Böhmermann eine Parodie darauf veröffentlicht und alle wieder total ironisch sein können.


 Aber wie die Musik stimmt: Fand ich die Band live schon ziemlich gut, vermisste aber so ein bisschen die Spannung, hat mir die selbstbetitelte Debüt-EP vom ersten Moment an die Schuhe ausgezogen. Der Sound, für den Produzent Oliver Zülch (noch so ein großer Name: The Notwist, Slut, Die Ärzte, Juli, …) verantwortlich zeichnet, ist glasklar. Die Gitarren, das Klavier und die Rhythmusgruppe bilden eine sehr gute Grundlage für die – Hilfe, ich muss schon wieder eine ausgelutschte Musikjournalistenvokabel benutzen! – ausdrucksstarke Stimme der Sängerin Katrin Biniasch.
Aber wie die Musik stimmt: Fand ich die Band live schon ziemlich gut, vermisste aber so ein bisschen die Spannung, hat mir die selbstbetitelte Debüt-EP vom ersten Moment an die Schuhe ausgezogen. Der Sound, für den Produzent Oliver Zülch (noch so ein großer Name: The Notwist, Slut, Die Ärzte, Juli, …) verantwortlich zeichnet, ist glasklar. Die Gitarren, das Klavier und die Rhythmusgruppe bilden eine sehr gute Grundlage für die – Hilfe, ich muss schon wieder eine ausgelutschte Musikjournalistenvokabel benutzen! – ausdrucksstarke Stimme der Sängerin Katrin Biniasch.