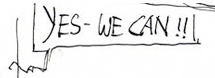Länger keinen Nazi-Vergleich mehr im Blog gehabt …
Abhilfe schafft da die Schauspielerin Susan Sarandan, seit jeher politisch aktiv. Sie hatte sich laut “Newsday” in einem Interview mit ihrem Schauspiel-Kollegen Bob Balaban am Wochenende wie folgt geäußert:
She was discussing her 1995 film “Dead Man Walking,” based on the anti-death-penalty book by Sister Helen Prejean, a copy of which she sent to the pope.
“The last one,” she said, “not this Nazi one we have now.” Balaban gently tut-tutted, but Sarandon only repeated her remark.
Die deutschen Medien griffen den Vergleich mit mehr als 24-stündiger Verspätung auf und hatten somit den Vorteil, die (erwartbare) Empörung gleich mitnehmen zu können:
Die jüdische Anti-Defamation League bezeichnete die mutmaßliche Bemerkung als “verstörend, schwer beleidigend und vollkommen unangebracht”. Die Bürgerrechtsorganisation Catholic League for Religious and Civil Rights nannte den angeblichen Kommentar “obszön”.
In ganz eigene Sphären schraubt sich “Spiegel Online” mit dem Remix einer Reuters-Meldung. Schon im Vorspann versucht sich der Autor an einer Art Meta-Vergleich:
Willkommen in der Lars-von-Trier-Liga für entgleiste Film-Größen: Die Schauspielerin Susan Sarandon hat Papst Benedikt auf einem Filmfestival in New York als Nazi bezeichnet. Ihr Interviewpartner versuchte, Schlimmeres zu verhindern.
Und wenn Sie jetzt sagen: “Hä? Lars von Trier hatte doch in einem irrlichternden Gedankenstrom irgendwelche prominenten Vertreter des Dritten Reichs genannt und sich dann, gleichsam als Pointe der Provokation, selbst als ‘Nazi’ bezeichnet. Das hat ja wohl außer dem Wort ‘Nazi’ (und der damit verknüpften erwartbaren Empörung) nichts mit dem aktuellen Fall zu tun!”, dann beweisen Sie damit nur, dass Sie nicht für “Spiegel Online” arbeiten könnten.
Der Artikel schließt nämlich mit diesen Sätzen:
Sarandon wird nun in den kommenden Tagen erfahren, wie sehr sich die Öffentlichkeit an Nazi-Vergleichen von Prominenten abarbeitet. Der dänische Regisseur Lars von Trier hatte sich auf den Filmfestspielen in Cannes erfolgreich um Kopf und Kragen geredet und Sympathie für Adolf Hitler bekundet. Nach einem Empörungstsunami ermittelt nun sogar die Staatsanwaltschaft.
Nun könnten die Fälle von Sarandon und von Trier kaum weiter voneinander entfernt sein: Bei der einen ist es ein Skandal, weil sie den ehrenwerten Benedikt XVI. recht unspezifisch einen “Nazi” geheißen hat, beim anderen war es ein Skandal, weil er Hitler und Speer gelobt und sich dann auf der Suche nach einem Ausgang aus dem rhetorischen Führerbunker in die Selbstbezichtigung als “Nazi” zu retten versucht hatte.
Aber vielleicht meint “Spiegel Online” mit dem verunglücktesten Nazi-Vergleichsvergleich aller Zeiten ja etwas ganz anderes: “Sag einfach mal öfter ‘Nazi’, und wir schreiben auch wieder über Dich!”
Nachtrag, 18 Uhr: Bild.de bemüht sich überraschenderweise um ein wenig Relativierung:
Nun muss man wissen, dass im US-amerikanischen Wortschatz die Bezeichnung “Nazi” auch für kalte, herrscherische Person gebraucht wird – allerdings bleibt ein fahler Beigeschmack, der bei Bill Donohue, Präsident der katholischen Liga, für Empörung sorgt.
Am Ende dreht dann aber auch dieser Artikel ab:
Wie schnell die Bezeichnung “Nazi” nach hinten losgehen kann, zeigte sich im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes. Star-Regisseur Lars von Trier (55, “Melancholia”) mit Hitler-freundlichen Äußerungen nicht nur für einen Skandal, sondern auch für seinen Ausschluss vom renommierten Festival gesorgt.