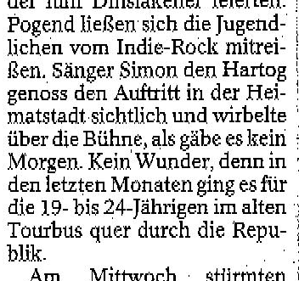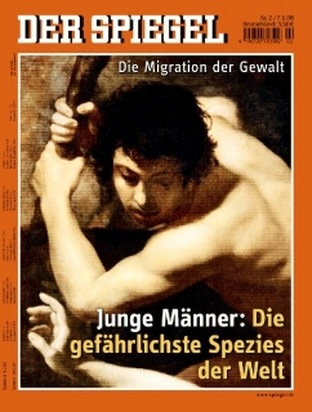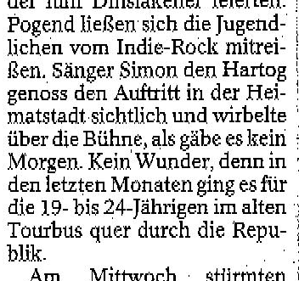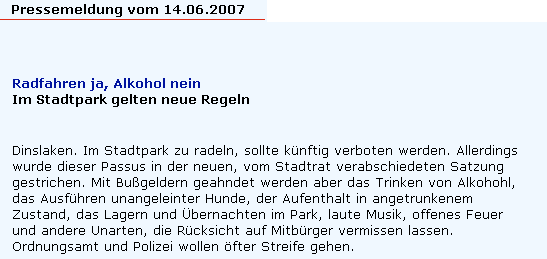Manchmal ist es erstaunlich, Freunde nach einiger Zeit wiederzusehen: Man fühlt sich dann wie die eigenen Großtanten, die einem als Kind immer in die Backe kniffen und “Du bist aber groß geworden!” riefen. Denn gestern habe ich meine Freunde von den Kilians nach fast einem Jahr zum ersten Mal wieder live auf der Bühne gesehen. Und wäre ich nicht ein Fan der allerersten Stunde, ich wäre gestern einer geworden.
Doch der Reihe nach: Im Rahmen der sympathischen Veranstaltungsreihe Fantastival, die sich seit vielen Jahren erfolgreich bemüht, einmal im Jahr Kultur in meine Heimatstadt zu holen, fand in diesem Jahr ein “School’s Out”-Festival statt, für das die Veranstalter neben den Lokalmatadoren Kilians auch Rearview und Massendefekt gebucht hatten – zwei Bands, von denen ich offen gestanden vorher noch nie etwas gehört hatte. Nachdem der Kartenpreis von 16 auf taschengeldfreundlichere fünf Euro gesenkt worden war, lief auch der Vorverkauf ganz ordentlich und da Jugendliche in ihrer eigenen Stadt lieber an die Abendkasse gehen, war das historische Burgtheater dann auch ganz gut gefüllt.
Eröffnet wurde der Reigen von Without Wax aus Wesel, die diesen Auftritt bei einer Art Talentwettbewerb im Vorfeld gewonnen hatte. Deren Gig habe ich leider prompt verpasst, weil ich grundsätzlich immer zu spät loskomme, aber Erzählungen glaubhafter Quellen zufolge war die Band “jünger als Tokio Hotel” und musikalisch sehr gut.
Dann ging es weiter mit Rearview, einer Band aus VerdammtichfindekeineStadtinderPresseinfo, die anfangs ein bisschen klangen, als sei Diana Ross mit Rage Against The Machine als Backing Band auf Tour (doch, das geht!) und sich danach irgendwo zwischen Krezip und Skunk Anansie einsortierten. Gar nicht mal so schlecht, aber als deutsche Band Ansagen auf Englisch machen und das Publikum beleidigen gibt Abzüge in der B-Note.
Es folgten nicht Massendefekt (wg. Krankheit, wie man hörte), weswegen ich immer noch nicht weiß, wie diese Band klingt. Wobei ich es mir aufgrund des Bandnamens irgendwie vorstellen kann. Ich hatte unterdessen meine Position als Biertrinkender Konzertbesucher gegen die der Biertrinkenden Aushilfe am Kilians-Merch-Stand eingetauscht und verkaufte kleinen Kindern (wirklich kleinen Kindern) Band-T-Shirts in Größe S und ihre vermutlich erste CD ever (welche sich später in Kneipengesprächen und Musikzeitschrift-Fragebögen natürlich ungleich besser macht als, sagen wir mal: die Lighthouse Family). Zu absolut Schulkinderfreundlicher Zeit (und das am letzten Schultag!) enterten die Kilians deshalb schon gegen halb neun die Bühne und das Publikum, das Rearview noch so brutal teilnahmslos gegen eine Wand aus Sitzbänken hatte anrocken lassen, geriet in Wallung.
Nun muss man zwei Dinge wissen: Erstens steht die Bühne im Dinslakener Burgtheater auf einer Empore, zu der einige sehr hohe Stufen hinaufführen, und zweitens ist die örtliche Dorfjugend dafür bekannt, sich auch bei lieblichen Indiekonzerten aufzuführen, als sei man gerade auf einem jener Hardcore-Konzerte, zu denen einen Mami und Papi nie hinfahren lassen. Ich halte Moshen bei Rockkonzerten eh für überaus unhöflich gegenüber den Konzertbesuchern, die sich das Konzert genussvoll und ohne körperliche Beeinträchtigung ansehen wollen, – wildes Herumgeschubse auf den Treppenstufen und eine Wall Of Death (na ja: eher ein Mäuerchen of Unwohlsein) bei einem Kilians-Konzert sind aber auch bei verständnisvollster Auslegung von Spaß fehl am Platze.
Nach nur wenigen Liedern hatten die überraschten Veranstalter auch schon bemerkt, was da vor sich ging (wer sonst Götz Alsmann, die Neue Philharmonie Westfalen und Musicalstars auftreten lässt, mag vom Verhalten der lokalen Jugend in der Tat auf dem falschen Fuß erwischt worden sein) und trieb die kritische Masse mit Flatterband die Treppe hinunter. Ein Jugendlicher wurde, nachdem er trotzdem vor der Bühne weitergetanzt und sich gegen die Ordner zur Wehr gesetzt hatte, von zwei Securitykräften aus dem Burgtheater geschleift und es ist alles in allem beinahe beruhigend, dass nur ein Konzertbesucher mit einer blutigen Nase ins Krankenhaus (wie es hieß) musste. Für Sekundenbruchteile schossen mir nämlich auch – sicher völlig übertrieben – Bilder vom Waldbühnenkonzert der Rolling Stones 1965 durch den Kopf.
Aber reden wir nicht von dummen Kindern und unvorbereiteten Veranstaltern, reden wir von der Band, der ich aus tiefster Überzeugung zutraue, neben den Beatsteaks eine der wichtigsten englischsprachigen Indie-Bands Deutschlands zu werden: den Kilians. (Zwischenruf: “Welche englischsprachigen Indie-Bands gibt es denn in Deutschland überhaupt noch neben den Beatsteaks?” Antwort: “Slut, Pale, The Robocop Kraus und bestimmt noch ein paar weitere, die mir gerade partout nicht einfallen wollen. Danke!”) Die Kilians jedenfalls haben im letzten Jahr derart viel Live-Erfahrung gesammelt, dass sie fast nicht wiederzuerkennen waren: Waren sie Anfangs eine sehr gute, aber mitunter etwas unbeholfen wirkende Liveband, sind sie inzwischen richtige Profis. Auch ohne meine persönliche Beziehung zu der Band würde ich sie für eine der besten des Landes halten.
<mode=”lokalzeitung”>Und so folgte ein Hit dem nächsten und wenn die Band gerade nicht rockte, unterhielt Sänger Simon den Hartog, der gerade sein Abitur gemacht hat, das Publikum mit launigen Ansagen.</mode=”lokalzeitung”>
Im Ernst: Das macht er inzwischen ganz toll und das einzige, was man ihm dabei vorwerfen könnte ist, dass er vielleicht einmal zu oft mit dem Band-Ziehpapa Thees Uhlmann von Tomte rumgehangen und sich einen Tacken zu viel von dessen Bühnenpräsenz abgeschaut hat – wobei es da sicher auch bedeutend schlimmere Vorbilder gäbe. Sie haben einige neue Songs gespielt, die ich noch gar nicht kannte, und die (neben den stets zu erwähnenden Strokes) unter anderem nach The Cooper Temple Clause, The Smiths und Radiohead klangen. Und dazu natürlich die ganzen schon bekannten Übersongs wie “Jealous Lover”, “Inside Outside”, “Dizzy”, “Take A Look” und die Single “Fight The Start”. Wenn man ein Kilians-Konzert beschreiben will, will man sich fast an den ekligen Rockjournalistenvokabeln “tight” und “erdig” vergreifen, aber man kann sich ja in die weniger schrecklichen Gefilde der Fansprache flüchten und das ganze einfach “toll” nennen.
Wer die Kilians in diesem Sommer noch live erleben will, hat dazu zahlreiche Gelegenheiten, die man alle auf der Bandseite nachlesen kann. In knapp einer Stunde werde ich sie schon auf dem Bochum Total wiedersehen – im strömenden Regen, wie es im Moment aussieht.
Nachtrag 22. Juni: Jetzt ist das mit der Lokalzeitungs-Vorhersage schon wieder schiefgegangen. Dafür erfahren wir aus der NRZ, dass der Verletzte mehrere Zähne verloren hat, und es gibt ein kleines Logikrätsel um die Konjunktion “denn”: