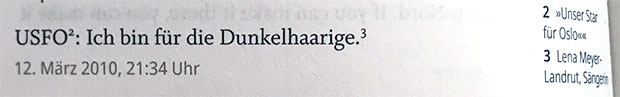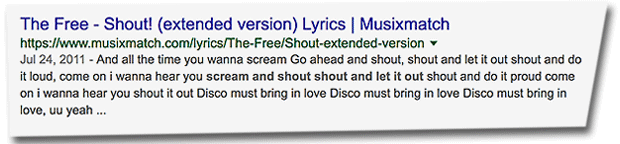Vorhin flogen zwei große Gruppen Zugvögel in beeindruckendem Formationsflug an meinem Wohnzimmerfenster vorbei, weswegen ich (nur zweieinhalb Jahre Biologie-Unterricht in der Schule) erst mal in der Wikipedia nachsehen musste, warum sie das überhaupt tun. Dabei fiel mir auf, dass “Schwarmverhalten” auch den leicht trotteligen Habitus bezeichnen könnte, den Menschen an den Tag legen, wenn sie sich in der Gegenwart eines anderen Menschen befinden, in den sie heimlich (bzw. zumeist unheimlich) verliebt sind, wobei meine Freunde mir schon mehrfach gesagt haben, dass niemand außer mir und der “Bravo” ein love interest als “Schwarm” bezeichnen würde. Dann fühlte ich mich mal wieder alt und leicht trottelig, wusste aber immer noch nicht, warum die blöden Vögel so fliegen, wie sie fliegen.
Ich mag den Winter. Nicht die grauen Novembertage, an denen es nie richtig hell wird, aber die klaren mit klirrender Kälte und Schnee. Wenn der erste Schnee fällt, fühle ich mich noch mehr wie ein Fünfjähriger als sowieso schon, und hole sofort meine Winterstiefel hervor. Es sind so ähnliche Schuhe, wie Jay-Z sie gerne trägt, nur dass ich sie schon seit mehr als 20 Jahren trage — natürlich nicht immer das selbe Modell, denn als Kind hätte ich in meinen aktuellen Schuhen Höhlen bauen können. Das aktuelle Paar habe ich jetzt seit zehn Jahren, was aber gar nicht so lang ist, wenn man bedenkt, wie viel Schnee wir im Ruhrgebiet so durchschnittlich haben. Ich würde tippen, in den zehn Jahren kamen die Schuhe auf etwa anderthalb kanadische Winter Einsatzzeit.
Das beste ist immer, die Schuhe zum ersten Mal anzuziehen: Sie sind im Vergleich zu meinen Füßen und sonstigen Schuhen so grotesk groß, dass ich erst mal überall gegenlaufe. Das ist eigentlich nicht schlimm, weil die Schuhe auch sehr stabil sind, aber trotzdem nicht ungefährlich: Beim Treppensteigen halte ich mich sicherheitshalber am Geländer fest, weil die Schuhe kaum auf eine Stufe passen und ich auch permanent Angst haben muss, zu stolpern. Die ersten Meter auf der Straße sind dann auch immer gewöhnungsbedürftig, weil die Schuhe so hohe Absätze haben, dass ich damit gerne an Bürgersteigen hängen bleibe. Stehen ist auch lustig, weil ich mit meinen Füßen meist leicht nach außen wippe. Wegen der hohen Absätze passiert es im Winter oft, dass ich an einer Supermarktkasse stehe und mir beide Füße gleichzeitig verknackse.

Noch schöner als Schnee ist natürlich Schnee mit Musik. Wenn ich durch die Stadt gehe und die Zufallswiedergabe meines iPhones schickt mir “So Long, Astoria” von den Ataris (erste Zeile: “It was the first snow of the season”), “The River” von Joni Mitchell oder den “Ally McBeal”-Titelsong “Searchin’ My Soul” von Vonda Shepard, lächle ich leicht debil vor mich hin. Überhaupt hat “Ally McBeal” mit den offenbar ständig verschneiten Straßen Bostons bei mir noch größere Verheerungen im Romantikzentrum angerichtet als “Dawson’s Creek” und “My So-Called Life” zusammen.
Seit ich in einer eigenen Wohnung wohne, wird diese im Dezember auch festlich geschmückt: Ich hänge Lichterketten in die Fenster (nach nur zwei Saisons war die erste schon dauerhaft kaputt und ein Fall für die Müllhalde) und stelle im Wohnzimmer einen etwa hüfthohen Tannenbaum auf. Diesen kaufe ich nun schon im dritten Jahr und damit traditionell in einem Baumarkt, drei Straßenbahnhaltestellen entfernt. Das Schlimme ist dabei nicht der Transport eines Baums in der Straßenbahn (da sind die Bochumer generell sehr hilfsbereit und kommunikativ), sondern der Weg vom Baumarkt zur Straßenbahnhaltestelle, den ich jedes Jahr aufs Neue unterschätze. Aber klar: geht alles, man wächst mit seinen Herausforderungen, ein bisschen Schwitzen in der dicken Winterjacke stärkt die Abwehrkräfte.
Wessen Leben arm an Action und Spannungsmomenten ist, dem kann ich nur empfehlen, einfach mal einen Tannenbaum zum groben Abtrocknen in der eigenen Dusche zu platzieren. Zumindest wenn man ein ähnlich gutes Kurzzeitgedächtnis hat wie ich, gibt es jedes Mal ein großes Hallo, wenn man die Toilette benutzen möchte und da plötzlich ein Baum im Bad steht. Das hilft auch gegen niedrigen Blutdruck, wobei der beim Aufstellen von Tannenbäumen eh nicht unten bleibt.
Ich kaufe meinen Baum immer eingetopft mit beschnittenen Wurzeln, weil ich mir immer noch 30 Jahre zu jung vorkomme, um einen Christbaumständer zu erwerben. Außerdem bilde ich mir ein, dass er in der Erde nicht so schnell zu nadeln beginnt. Die Anzahl der Nadeln, die er auf dem Weg von der Haustür über das Bad ins Wohnzimmer verliert, ist dennoch beachtlich. Man sollte sich anschließend nicht zu schade sein, einmal gründlich durchzusaugen — zumindest, wenn man anschließend noch barfuß durch seine Wohnung spazieren möchte. Tannennadeln sind zwar eigentlich sehr flach, haben aber einen natürlichen Überlebenswillen, der sie zwingt, sich auch in den ausweglosesten Situationen noch dergestalt senkrecht aufzurichten, dass sie im menschlichen Fuß maximalen Schaden anrichten können. In den Entwicklungslabors von Lego werden Tannennadeln deshalb ganz besonders ausgiebig studiert.
Steht der grüngekleidete Wintergast dann erst mal an seinem Platz (die Frage, ob er nicht “schief steht”, verbietet sich bei eingetopften Bäumen zum Glück — man kann eh nix ändern), kommt die elfte Plage aus dem elften Kreis der Hölle: die Lichterkette. Ganze Kleinkunstabende werden im Spätherbst und Frühwinter mit der Beschreibung dessen beschritten, was der Mensch (auch in emanzipierten Haushalten zumeist: der Mann) denkt, fühlt, oder präziser: hasst, während er versucht, 16 untereinander verbundene Leuchtelemente an einen kaktusähnlichen Baum zu klemmen, ohne sich in dem Kabel zu verheddern. Es geht nicht. Eine gerechte Verteilung der Kerzen über den ganzen Baum ist nicht möglich, am Ende sieht es immer aus wie ein Satellitenbild von Australien bei Nacht. Das Kabel ist immer da, wo es nicht sein soll, und letztlich sollte man schon dem Herrgott danken, wenn man nicht den ganzen Baum zu Boden reißt.
Es gibt in dem Weihnachtsklassiker “Schöne Bescherung” die schöne Szene, in der Clark Griswold zu seinem Vater sagt: “Alles, was ich über Weihnachtsaußenbeleuchtung weiß, habe ich von Dir gelernt, Dad!” Dieser eine Satz sagt mehr über die Psyche von Männern aus, als die Lebenswerke von Alice Schwarzer und Mario Barth zusammen. Wer Männer verstehen will, sollte hier anfangen und aufhören.

Ist die Lichterkette aber endlich in Betrieb (und der Baum hoffentlich eichhörnchenfrei), geht alles ganz schnell: Das Gebimmel (zwei Christbaumkugeln und drei sonstige Hänger) ist in einem kleinen Baum wie meinem schnell verstaut und wenn endlich auch die Krippe steht, heißt es innezuhalten und zu genießen. Der Geruch von Tannengrün ist (neben dem von frisch bearbeitetem Holz und dem von Meer) vermutlich der schönste auf der Welt, die größte Kindheitserinnerung sowieso. Er ist der Proust’sche Instant-Reminder an die Weihnachtstage der Kindheit, als ich irgendwann kurz nach Sonnenaufgang aus dem Bett hüpfte und ins Wohnzimmer rannte, um mit meinen neuen Spielsachen zu spielen. Barfuß saßen meine Geschwister und ich unter dem festlich geschmückten Baum, dessen schon verlorene Nadeln gemeinsam mit dem Hochflorteppich eine letzte, unheilige Allianz eingegangen waren (s.o.), und widmeten uns intensiv unseren Lego-Flughäfen und Playmobil-Ritterburgen, die wir natürlich direkt nach der Bescherung hatten aufbauen müssen (“Du bist doch schon so müde, willst Du das nicht lieber morgen machen?” — “NEIN!”).
Diese kindliche, unschuldige Begeisterung, die noch nichts ahnt von abbrechenden und verloren gehenden Plastikteilen, von kostspieligen Zubehörsets und viel besseren neuen Versionen, glimmt im Erwachsenenleben manchmal noch auf, wenn ein noch jungfräulicher Laptop oder ein flammneues Smartphone behutsam aus seiner Verpackung genommen wird. Doch dann gilt man schnell als komplett bescheuert — nicht ganz zu Unrecht, wenn man die Entpackungszeremonie gleichzeitig auch noch auf Video aufgenommen und ins Internet gestellt hat. Ich hoffe, dass das “Unboxing” von Weihnachtsgeschenken, dieser ganz intime Glücksmoment eines Kinderlebens, niemals online verwurstet wird.
Bis vor ein paar Jahren haben meine Geschwister in der Adventszeit auch immer noch gebacken. Dieses heimelige Gefühl völligen Größenwahns, wenn man ein Kilogramm Schokolade und 800 Gramm Butter im Wasserbad zum Schmelzen bringt! Aber erstens sah die Küche unserer Eltern danach jedes Mal aus, als habe es ein Massaker bei Willy Wonka gegeben, und zweitens ist irgendwann jemandem aufgefallen, dass irgendwer den ganzen Scheiß ja hinterher auch essen muss. Ich habe bei der Renovierung meiner Wohnung vor drei Jahren die dämmende Wirkung von Schokoladen-Brownies sehr zu schätzen gelernt.
Die blöden Vögel sind lange weg. Ich liege neben meinem Tannenbaum und versuche so unauffällig an ihm zu riechen, wie man im Vorbeigehen an seinem Schwarm zu riechen versucht. Meine Füße tun fast nicht mehr weh. Es ist Advent.