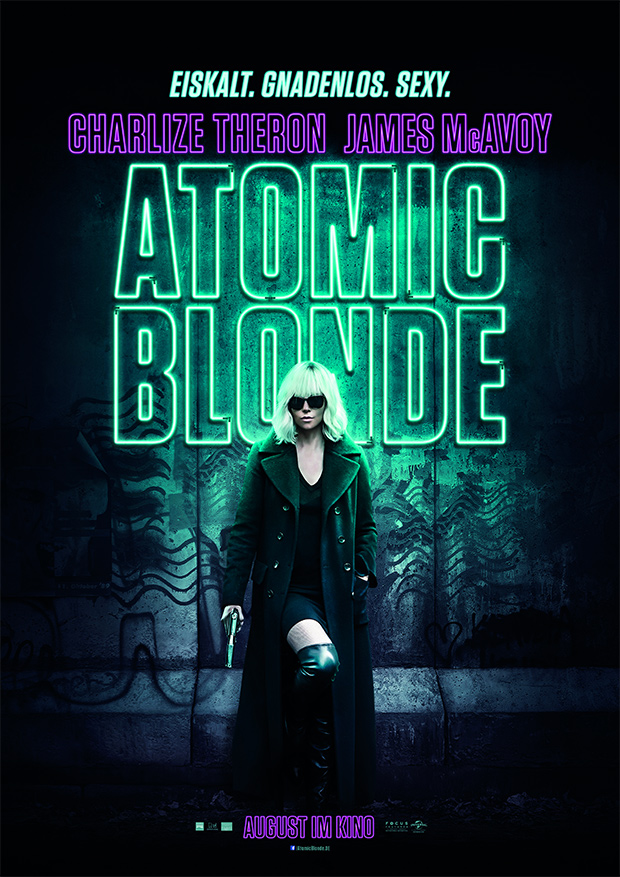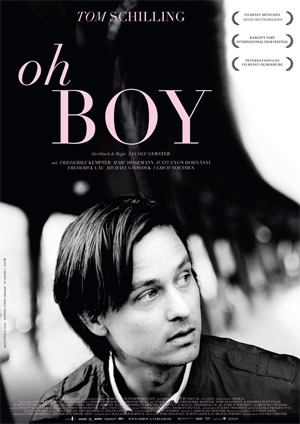Seit Tagen wurde ich von Freunden darauf hingewiesen, dass am gestrigen Samstag auf arte die endgültige Demaskierung von Lena Meyer-Landrut zu bestaunen sei. Die sei nämlich doof, zickig und wahnsinnig anstrengend, so war es vorab in den Medien zu lesen.
Die „Spex“ verkündete:
Dabei knüpft Lena an die fragwürdigen Dauerinterviews rund um ihre gescheiterten Titelverteidigung in diesem Jahr an, als das Bild vom ganz natürlichen Liebling der Nation erste Risse bekam.
Und die „Visions“ nutzte die Gelegenheit, auf dem doofen, doofen Mainstream-Publikum rumzuhacken:
Bleibt nur zu hoffen, dass die Episode von „Durch die Nacht mit“ das Bild von Lena als süßes, keckes Mädchen in den Köpfen der tumben Masse relativiert.
Beides sind keine Medien, in denen Lena sonst groß stattfindet, und vielleicht hatten beide das Bedürfnis, den anderen Teilnehmer von „Durch die Nacht mit“ beschützen zu müssen: den Indie-Liebling Casper, mit dessen Musik ich nach wie vor nicht viel anfangen kann, den ich in Interviews aber oft sehr sympathisch finde.
Ich hatte es vorher schon geahnt und tatsächlich bestätigte die fertige Sendung, dass alles so schlimm nicht werden würde. Im Gegenteil: Es war eine hochvergnügliche Tour durch Berlin, die (im Gegensatz zu anderen im Vorfeld hochgejazzten Sendungen) durchaus das Zeug zum Klassiker hat – nur halt ganz anders als gedacht.
Der Start ist tatsächlich kein guter: Lena kommt in Caspers Wohnung, beide stehen ein bisschen krampfig rum und Lena sagt: „Ja, schön. Schön eingerichtet, schön dreckig auch!“ Damit bricht sie erst mal so ziemlich alle zwischenmenschlichen Konventionen, die so in den vergangenen Jahrhunderten zum Thema Höflichkeit entwickelt wurden. Vielleicht würde man den Privatbesuch, der einem so etwas sagt, auf der Stelle achtkantig wieder rausschmeißen – aber zu Beginn einer Fernsehsendung ist das doch ein spannender Auftakt, der das Gegenüber aus der Reserve holen könnte. Könnte, denn hier klappt es nicht.
Nach dem missglückten Auftakt sieht es erst mal nicht gut aus: Lena und Casper haben nicht den gleichen Geschmack bei Tattoomotiven (können sich aber darauf einigen, dass Leute, die dem Tättowierer ihre Lebensgeschichte erzählen, bestimmt super-anstrengend sind), bei Musik, bei der Abendplanung. Casper sitzt erst mal ziemlich nervös neben ihr, was aber auch sehr sympathisch wirkt. Lenas „Du malst jetzt echt ’ne Katze und so’n Kack, ne?“ liest sich transkribiert nach großer Boshaftigkeit, kommt im O‑Ton in der Situation dann aber doch deutlich kumpelig-flapsiger rüber.
Tatsächlich gibt es zahlreiche harmonische Momente, zum Beispiel die Szene, in der beide erzählen, dass sie nicht in einem Raum bleiben könnten, in dem ihre eigene Musik läuft, und Lena dann kurz zu Höchstleistungen aufläuft:
[sublimevideo class=„sublime“ poster=““ src1=„http://www.coffeeandtv.de/wp-content/uploads/2012/01/haltsmaul.m4v“ width=„540“ height=„304“]
Das hier ist dann wieder nicht so gut:

Grandios aber auch die Szene, wo die beiden in einem futuristischen Wohnraumkonzept voller riesiger aufgeblasener Plastikkugeln sitzen und Casper anfängt: „Wenn man sich das jetzt als Wohnung der Zukunft vorstellt …“, bevor Lena das ganze intellektuelle Künstler-Konzept mit einem „… isses scheiße!“ kurz und knapp hinrichtet. So jemanden wie Lena braucht man in den Galerien, Konzertsälen und bei Poetry Slams, die von Leuten besucht werden, die mal gehört haben, dass sie dort Kunst erwarte.
Wirklich menscheln kann’s dann zum Beispiel in dem Moment, wo Lena „pinkeln“ ist und Casper sich nett und ungezwungen mit zwei Museumsbediensteten unterhalten kann: „Wir halten doch die Menschen von ihrem Feierabend ab!“ Lena wird ihm anschließend auf verstörend abgeklärte Art erklären, die beiden Mädchen seien total verliebt in ihn gewesen, was Casper überrascht zurückweist und ich weiß, das hört sich jetzt nicht spektakulär an, aber ich saß davor und rief entzückt „ist das toll!“ in den sonst menschenleeren Raum.
Irgendwann haben die beiden dann eine Ebene gefunden, auf der sie sich durchaus humorvoll gegenseitig angehen können: „Ich würd‘ Dir noch ’n Alster austun, wenn Du magst!“ – „Austun?!“, „Ist das Deine echte Schrift?!“, „Na, das ist ja jetzt scheiße!“ – „Wieso ist das scheiße? Du bist scheiße!“ – „Du bist scheiße!“. Man muss das natürlich sehen und hören, denn in Schriftform taugt es tatsächlich zu der Skandalisierung, die die Medien im Vorfeld versucht hatten. Besorgniserregenderweise klangen ausgerechnet die Redakteure der Musikzeitschriften dabei wie ihre eigenen Großeltern, aber vielleicht sind das halt so Veganer, die zum Lachen in den Keller gehen und bei YouTube immer verzweifelt nach dem einen geilen Indie-Song suchen müssen, der noch nicht mehr als 34 Views hat. Lena und Casper zuzusehen ist jedenfalls, wie mit meinen Freunden unterwegs zu sein: hart, aber doch durchaus herzlich.
Nachdem die beiden Nachts durch die leeren Flure der Deutschen Popakademie (gähn!) gelaufen sind und in ein Zimmer mit Instrumenten gesperrt wurden, spielen sie Galgenmännchen. Das allein ist ja schon großartig abwegig, aber dann wird Frau Meyer-Landrut wieder gehässig, Herr Casper zickt zurück und herein platzt der wahnsinnig umtriebige Mann von der Popakademie, der von der „Lounge“ erzählt, die „das Herzstück der Akademie“ sei. Eigentlich ist es ein Wunder, dass in diesem Moment niemand vierhundert Arosa schlitzverstärkt mit kurzem Arm bestellen will, aber dann sitzen sie halt in dieser „Lounge“, trinken Mineralwasser und führen ein (wie Casper und Lena hinterher offen zugeben) eher zähes Gespräch mit Studenten. Jeder Versuch des Akademie-Manns, sich und seine tolle Institution irgendwie ins Gespräch einzubringen, prallt grandios ab und das geschieht ihm in diesem Moment ehrlich gesagt ganz recht.
Dass eine Frau eine andere beim ersten Händedruck vor allen Leuten fragt, ob die Wimpern echt oder angeklebt seien, verstößt mal wieder gegen so ziemlich alle zwischenmenschlichen Konventionen – aber es ist eben auch genau diese Authentizität, für die Lena mal eine kurze Zeit von den Medien geliebt wurde. Lena liefert nicht das, was die Medien bei ihr bestellen. Der Beobachtereffekt, der eigentlich zwangsläufig alle Natürlichkeit zerstört, sobald eine Fernsehkamera dabei ist, bleibt aus, stattdessen fragt man sich ständig, ob sie das jetzt grad wirklich wieder gesagt hat. Doch, hat sie: Der Frau mit den „natürlich echten“ Wimpern sagt sie zum Abschied: „Ich finde, Du könntest mir ’n bisschen was von Deinen Brüsten abgeben!“
Was die Medien vorab nicht für erwähnenswert hielten, ist etwa die Szene, in der die beiden im Auto voller Hingabe „Son Of A Preacher Man“ oder „Big In Japan“ singen, wobei sie die Texte von einem iPhone-Display ablesen müssen, oder die, wo sie sich Pommes essend über Fans beklagen, die Promis in privaten Situationen behelligen, und Lena dann unvermittelt und mit verklärtem Blick über Turnschuhe zu sprechen beginnt.
Das heißt: „Welt Online“ hat das erwähnt, fasste es aber als Unprofessionalität auf und bölkte:
Offensichtlich wird an diesem Abend, dass die beiden mit ihrer Rolle als Prominente noch überfordert sind.
Natürlich war „Durch die Nacht mit Liza Minnelli und Fritz Wepper“ schön, weil da zwei Vollprofis, die sich ewig kennen, formvollendet miteinander umgingen, aber das andere Ende des Spektrums kann ja genauso spannend sein, wenn man sich denn drauf einlassen will.
Man kann sich doch nicht einerseits über die ganzen stromlinienförmigen Popsternchen, Fußballer und Politiker der Gegenwart beklagen und dann andererseits sofort Zeter und Mordeo schreien, wenn mal jemand vorbeikommt, der unkonventionell und anders ist. Man muss das ja noch nicht mal als Natürlichkeit preisen und sich darüber freuen, man muss Lena oder Casper nicht mal mögen, aber man könnte doch zumindest mal anerkennen, wenn da plötzlich „Stars“ auftauchen, die anders sind. Die müssen dann natürlich nicht „Liebling der Nation“ sein, aber wer würde das auch wollen?
Ich hab in letzter Zeit von mehreren Kollegen gehört, dass Lena anstrengender und weniger locker geworden sei. Von Casper heißt es, dass er sich nach dem Abend regelrecht ausgeheult bzw. ausgekotzt haben soll. Das mag alles sein, nur die dabei entstandene Sendung taugt nicht zum Beleg. Ja: Lena hat offensichtlich keine große Lust auf die ganze Sache, sie zickt rum und Casper zickt zurück – aber das kann doch niemand, der in den letzten zwanzig Jahren mal mit jungen Menschen zu tun hatte, ernst nehmen! Man muss sich doch als Musikmagazin nicht dem Skandalisierungswahn der anderen Medien anschließen und wie die „Spex“ „fast die Eskalation“ herbeischreiben!
Selbst der Abschied der beiden voneinander oszilliert vielfarbig zwischen Neid, Gehässigkeit und schlichter Freude an exakt dieser Situation. Natürlich gibt es Szenen, in denen man ahnt, welche Leistung Cutter Martin Eberle erbracht haben muss, um aus vielen schwierigen Situationen einen erträglichen Film zu schneiden, aber es ist ihm gelungen.
„Durch die Nacht mit Lena und Casper“ ist noch bis nächsten Samstag in der arte-Mediathek verfügbar.
Offenlegung: Ich bin Frau Meyer-Landrut ein paar Mal begegnet und finde sie recht sympathisch.