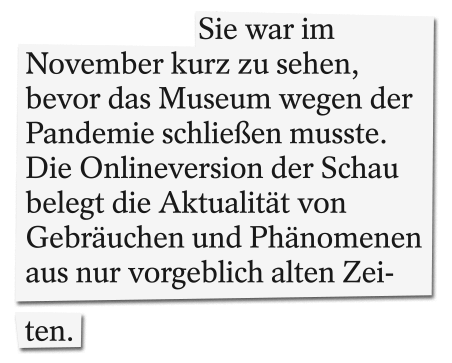Hey, wie war denn Euer Jahr 2021 so? Genau. Mit Konzerten und Festivals war das ja alles noch so eine Sache, aber Musik war natürlich trotzdem da — und gerade zu Beginn des Jahres, als alles noch so richtig scheiße war (könnt Ihr Euch noch erinnern, dass wir im April eine Ausgangssperre hatten?!), hat sie getröstet und verbunden.
Nachdem ich zu Beginn des letzten Jahres großspurig verkündet hatte, nie wieder eine „Alben des Jahres“-Liste zu veröffentlichen, weil manche Acts gar keine Alben mehr veröffentlichen und andere gleich zwei, brauchte ich irgendeine andere Kategorie, in der ich zu Beginn des nächsten Jahres (ach, komm: is noch Anfang 2022!) Namen sortieren und mir erläuternde Texte aus den Fingern saugen können würde.
Herzlich Willkommen also bei meiner ersten „Acts des Jahres“-Liste, die es mir ermöglicht, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen:
10. Måneskin
Dass Italien irgendwann noch mal den ESC gewinnen würde, hatte in den letzten zehn Jahren deutlich in der Luft gelegen. Dass sie es mit einer Rockband tun würden, die klingt und aussieht, als wären ihre Mitglieder die letzten 45 Jahren eingefroren gewesen, nicht unbedingt — aber es hat dann auch nicht weiter überrascht. Womit nun wirklich nicht zu rechnen gewesen war: Dass diese ESC-Sieger*innen zwei Wochen nach dem Song Contest noch nicht vergessen waren; dass „I Wanna Be Your Slave“, die zweite Single aus ihrer EP „Tatro d’ira – Vol. 1“ (RCA/Sony; Apple Music, Spotify), in der sie relativ offen ungefähr alle sexuellen Spielarten durchdeklinieren, ein noch größerer Hit werden würde, der im Radio läuft und von deutschen Grundschulkindern begeistert mitgesungen wird; dass diese Band mit einer vier Jahre alten Coverversion die weltweiten Spotify-Charts anführen würde; dass sie bei Jimmy Fallon und „Saturday Night Live“ auftreten und für die relevantesten Musikfestivals beiderseits des Atlantiks gebucht werden würden.
Kurzum: So etwas hatte es in der 65-jährigen Geschichte des ESC (über die Ende Februar ein sehr lesenswertes Buch erscheint) noch nicht gegeben. Die Band hat den ESC ins 21. Jahrhundert katapultiert (worauf wir bei der neuen Bundesregierung noch warten) und ist nebenbei die erste mir bekannte Rockband seit vielen, vielen Jahren, die derart durchstartet.
So. Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, Sie hätten zwei Wochen lang jeden Morgen zehn Meter von diesen soon to be-Megastars entfernt gefrühstückt und wären nicht einmal auf die Idee gekommen, nach einem gemeinsamen Selfie zu fragen!
9. Weezer
Was Taylor Swift kann, können Weezer schon lange: Zwei Alben in einem Jahr zu veröffentlichen passiert der Band jedenfalls nicht zum ersten Mal. Im September 2019 hatten sie ihr 14. Album „Van Weezer“ (Crush Music/Atlantic; Apple Music, Spotify) angekündigt, das im Mai 2020 erscheinen sollte. Wie so vieles andere wurde auch der Release dieses Albums verschoben — das Tribut an die großen Hair-Metal-Bands (das durch den zwischenzeitlichen Tod von Eddie van Halen eine zusätzliche Ebene erreicht hatte) erschien im Mai 2021 und war okay, aber nicht atemberaubend.
Interessanter war „OK Human“ (Crush Music/WEA; Apple Music, Spotify), das zweite Album, das Weezer zwischen der Fertigstellung und dem verspäteten Release von „Van Weezer“ aufgenommen hatten (was es so gesehen zu ihrem 15. Album macht, chronologisch aber natürlich „Van Weezer“ nach hinten drängt und somit offiziell Nr. 14 ist — aber die Beatles hatten „Abbey Road“ ja auch nach „Let It Be“ aufgenommen und vor diesem veröffentlicht).
Es wurde ohne elektrische Gitarren, aber mit einem 32-köpfigen Orchester eingespielt, was ihm den Sound eines Unplugged-Albums (oder von Ben Folds’ „So There“) verleiht, nur dass es zwölf brandneue Songs sind und keine neu eingespielten Hits. Es klingt also wärmer, enthält aber ansonsten klassische unwiderstehliche Weezer-Melodien und clevere Texte über das Leben in Zeiten von Gentrifizierung, Smartphones und unzähligen Zoom-Calls. Wenn „New Yorker“-Cartoons Musik wären, wären sie dieses Album!
8. Danger Dan
Ich hatte natürlich noch nie bewusst irgendwas von der Antilopen Gang gehört, als sich mein halber Freundeskreis überschlug, ich müsse jetzt unbedingt diese ZDF-Sendung schauen, in der ein Mann namens Danger Dan, der Mitglied besagter Hip-Hop-Band sei, gemeinsam mit Thees Uhlmann durch die Gegend ziehe und am Klavier seine neuen Solo-Songs spiele. Oooookay! Nicht alle Songs haben mich abgeholt, aber „Lauf davon“ ist natürlich ein Meisterwerk der Melancholie; gleichzeitig Punk und Romantik, als hätte sich Rio Reiser mit Igor Levit zusammengetan. „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ war mir erst einen Tacken zu Jan-Böhmermann-Twitter-ironisch, aber die dritte und vierte Strophe haben mich mit offenem Mund vor dem Fernseher sitzen lassen: Wie er da mit Ken Jebsen, Jürgen Elsässer, Alexander Gauland, AfD, rassistischen Polizisten abrechnet, so etwas hatte ich im Pop selten gehört.
Und dann kam „Eine gute Nachricht“ raus: Ein unendlich poetisches, komplett unpeinliches Liebeslied; eines der besten, das je geschrieben wurde — und das auf Deutsch!
Zum Album, das auch „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ (Antilopen Geldwäsche; Apple Music, Spotify) heißt, habe ich ein gespaltenes Verhältnis – manche Lieder sind mir zu „lustig“, auf ganze Länge ist es mir ein bisschen zu monoton, aber das ist eigentlich egal: Schreibt mal drei Songs, die so unterschiedlich reinhauen, und dann reden wir weiter!
7. Big Red Machine
Beim ersten Album war Big Red Machine noch die Mini-Supergroup von Justin Vernon (Bon Iver) und Aaron Dessner (The National) gewesen, in der Zwischenzeit hatten die beiden mit Taylor Swift für deren Meisterwerke „Folklore“ und „Evermore“ zusammengearbeitet und so kam die Präsidentin des Pop fürs zweite Album „How Long Do You Think It’s Gonna Last?“ (Jagjaguwar/37d03d; Apple Music, Spotify) zum Gegenbesuch vorbei und traf dort unter anderem auf Anaïs Mitchell, die Fleet Foxes (was ist eigentlich aus denen geworden?!), Sharon van Etten, Ben Howard und andere, die gemeinsam mit Vernon und erstaunlich viel Dessner, der zuvor noch nicht groß als Sänger in Erscheinung getreten war, melancholisch-hymnische Lieder anstimmten. (Dass es sich die Band erlauben kann, den gemeinsamen Song mit Michael Stipe gar nicht erst aufs Album zu packen, sagt schon viel aus!)
Nun läuft ein Album bei so vielen Stimmen schnell Gefahr, eher nach Mixtape zu klingen, aber was heißt hier „Gefahr“?! Wenn es ein so stimmungsvolles, in sich geschlossenes Mixtape ist, wer würde sich da beschweren?!
6. The Wallflowers
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Wallflowers neun Jahre nach ihrem letzten Album (das neben einer The-Clash-Huldigungs-Single nicht so richtig viel zu bieten hatte) und nach dem Ausstieg der letzten Bandmitglieder, die nicht Jakob Dylan hießen, überhaupt noch mal ein Album aufnehmen würden. Doch nach ein paar Vorab-Singles war „Exit Wounds“ (New West Records/LLC; Apple Music, Spotify) da und schloss eigentlich nahtlos an ihr 25 Jahre altes Erfolgsalbum „Bringing Down The Horse“ an: Americana-Musik über die ganz großen Themen, bei vier Songs grandios unterstützt durch Shelby Lynne.
Es ist Musik für Männer in Chucks und Karohemden, die langsam, aber sicher auf die 40 zugehen (oder schon lange darüber hinaus sind), aber in Zeiten wie diesen ist es toll, Musik zu haben, die wie ein großer Bruder oder ein junger Onkel zu einem kommt und sagt: „Hier ist ein Bier für Dich, mein Pick-Up-Truck steht vor der Tür — jetzt fahren wir in den Sonnenuntergang, schnacken ein bisschen und alles wird gut!“
5. Wild Pink
Es war wenig überraschend „All Songs Considered“, wo ich erstmals auf die Musik von Wild Pink traf. „A Billion Little Lights“ (Royal Mountain Records; Apple Music, Spotify), das dritte Album der New Yorker Band, erwies sich als die perfekte Frühlingsmusik: ein bisschen pastellig-optimistisch, ein bisschen schläfrig-melancholisch; zwischen Joshua Radin, Rogue Wave und Stars; organisch, mit gelegentlichen Country-Gitarren und cleveren Texten.
Vor zwölf, dreizehn Jahren wäre solche Musik bei „Scrubs“ oder in iPod-Werbespots gelaufen, heute hört man sie allenfalls noch auf dem Haldern-Pop-Festival — wenn es denn stattfindet.
4. Vanessa Peters
Lustig, wie man 2021 Musik entdeckt: Instagram hatte mir im Frühjahr das Video zu einem Song namens „Crazymaker“ als Werbung ausgespielt und ich hab den Song sofort auf meine Playlist gepackt. Im Herbst hab ich dann mal nachgeschaut, was die Sängerin dahinter noch so macht.
Hinter dem Namen „Vanessa Peters“ vermutete ich – deutsch ausgesprochen – erst mal eine Frau, die in irgendeiner frühen DSDS-Staffel mal den dritten Platz belegt hatte und/oder mal Vorletzte beim ESC wurde (man kann ihn aber bequem amerikanisch aussprechen, denn sie stammt aus Texas), und das Roy-Lichtenstein-für-Arme-Cover ihres Albums „Modern Age“ (Idol Records; Apple Music, Spotify) hat mich zunächst auch etwas abgeschreckt.
Oberflächlicher Scheiß, denn die Musik ist toll: Als hätten Aimee Mann, Suzanne Vega und Kathleen Edwards eine Supergroup gegründet. Sehr amerikanisch, obwohl die backing band komplett aus Italienern besteht.
3. Emily Scott Robinson
Ich hatte noch nie von Emily Scott Robinson gehört, als ihr drittes Album „American Siren“ (Oh Boy Records; Apple Music, Spotify) – natürlich – bei „All Songs Considered“ vorgestellt wurde. Das bittersüße Trennungslied „Let ’Em Burn“, das dort lief, repräsentiert das Album als Pianoballade musikalisch einerseits nicht so richtig, andererseits passt es aber auch perfekt in dieses Album mit seinen oft reduzierten Country- und Folksongs mit klugen und gesellschaftskritischen Texten.
Es ist das Album, das Kacey Musgraves 2021 leider nicht gemacht hat, es erinnert an Lori McKenna und Hem und es ist einfach wunderschön!
2. Meet Me @ The Altar
Hat jemand „queer POC all-girl pop-punk band“ gesagt? Count me in!
Natürlich war es auch wieder „All Songs Considered“, wo ich zum ersten Mal von Meet Me @ The Altar gehört habe. Musikalisch kann man sie als Teil des 2000er-Revivals, irgendwo zwischen blink-182 und Paramore, Taking Back Sunday und Avril Lavigne, ansehen (und sie sind eine der wenigen jungen Bands, die beim großen Zu-schön-um-wahr-zu-sein-Emo/Pop-Punk-Festival „When We Were Young“ in Las Vegas spielen werden), aber die Texte sind irgendwie reflektierter als die unserer damaligen Mitgröl-Hymnen.
Das ist die Energie, die ich im vergangenen Jahr gebraucht habe! Nach ihrer EP „Model Citizen“ (Fueled By Ramen; Apple Music, Spotify) hat die Band für 2022 ein Album angekündigt, was bei so jungen Leuten dann doch überraschend ist. Und schön.
1. Sir Simon & Burkini Beach
„Hä? Hast Du jetzt zwei Acts auf Platz 1 gepackt, Lukas?!“
Jau. We make up the rules as we go along.
Aber der Reihe nach: Sir Simon ist natürlich Simon Frontzek, der unter diesem Namen schon 2008 und 2011 zwei ganz tolle Indiepop-Alben veröffentlicht hatte, seitdem aber nichts eigenes mehr. Er spielt seit 2019 in der Band von Thees Uhlmann — und zwar zusammen mit Rudi Maier alias Burkini Beach. Als sie 2020 überraschend viel Zeit hatten, haben die beiden einfach zusammen zwei Alben geschrieben und aufgenommen: eben eins für Simon („Repeat Until Funny“, Comfort Noise; Apple Music, Spotify) und eins für Rudi („Best Western“, Comfort Noise; Apple Music, Spotify). Die sind im August am gleichen Tag erschienen und der letzte Song auf beiden Alben ist jeweils – und ich bin mir sehr sicher, dass es diese geniale, eigentlich total naheliegende Idee in der Musikgeschichte bisher noch nie gegeben hat – „Not Coming Home“, ein Duett zwischen den beiden.
Man kann diese Alben also kaum getrennt voneinander beurteilen — und das muss man auch gar nicht, denn sie sind beide wunderschön geworden und haben mich ab August durchs Jahr getragen. „Repeat Until Funny“ klingt, um mal meinen besten Freund zu zitieren, ein bisschen wie ein bisher unveröffentlichtes Weakerthans-Album, „Best Western“ wie eins von Death Cab For Cutie (und wir meinen nicht, dass es wie ein Abklatsch klingt, sondern dass da zwei Menschen, die Musik wirklich lieben und verinnerlicht haben, im Äther der Musik ihre eigenen Sprachen und Stimmlagen gefunden haben und diese jetzt mit uns teilen). Auch die Texte sind wirklich sehr klug und lustig, was ja bei deutschen Acts, die auf Englisch singen, jetzt auch nicht unbedingt immer der Fall ist. Also: Ja, es sind wirklich zwei gute Alben und weil man sie nicht trennen kann, stehen sie beide hier vorne! („Vorne“ im sonst eher ungebräuchlichen Sinne von „ganz am Ende des Textes“, aber eben auf Platz 1. Hier muss dieser Blog-Eintrag enden.)

In ein paar Wochen hätte ich Euch die Geschichte erzählt, wie ich vor 20 Jahren, ganz kurz vor dem allerletzten Schultag, mit meinem Fahrrad zu R&K gefahren bin, um mir die „There Is Nothing Left To Lose“ von den Foo Fighters zu kaufen. Das Album war damals schon fast drei Jahre alt, aber ich hatte ein paar Wochen vorher zum wiederholten Male das Video zu „Next Year“ im Musikfernsehen gesehen und eine solche Obsession für diesen Song entwickelt (illegaler MP3-Download und so), dass ich das Album dringend haben musste und sogar die Geburtstagskaffeetafel meiner Schwester dafür verließ. Das Album und die Single (die so untypisch für die Foo Fighters ist, dass sie auf dem Best Of fehlte) wurden der Soundtrack der völlig unbeschwerten Zeit zwischen Abi-Prüfungen und Zivildienst. Noch heute hüpft mein Herz jedes Mal, wenn der Song bei 3:48 eigentlich schon zu Ende ist, aber mit dem zweitgrößten Drum-Break nach „In The Air Tonight“ zur Ehrenrunde ansetzt.