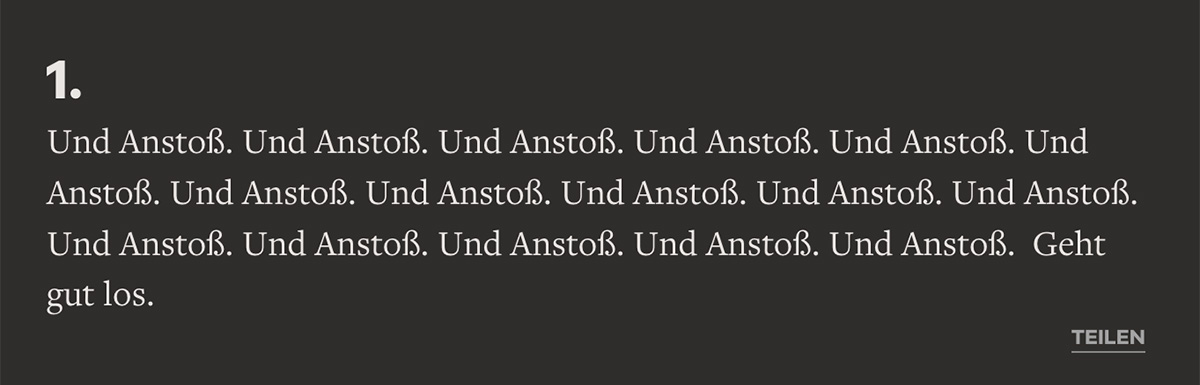Für Günter und Jürgen, die ich ohne dieses Blog nie kennengelernt hätte.
Und für Dörte, die immer alles gelesen hat.
Es war die naheliegendste Idee der Welt: Zum 18. Geburtstag des Blogs wähle ich einen Song aus jedem Jahr aus — fertig ist die Playlist!
Aber nach welchen Kriterien? Einfach das Lied nehmen, das jeweils meine Liste „Song des Jahres“ angeführt hat? Das wäre ja ein bisschen langweilig — und solche Listen gab es auch gar nicht in jedem Jahr.

Also: 18 andere Songs. Welche, die ihr jeweiliges Jahr, aber auch dieses Blog gut repräsentieren; die für mich eine persönliche Bedeutung haben; die ich auch heute noch höre. Eine halbwegs ausgewogene Mischung aus Genres, Geschlechtern und Sprachen, also eben dann doch auch: Kontext.
Und so wurde aus einem kleinen Gimmick zum Jubiläum eine ausufernde Recherche-Aktion im eigenen Leben ’n‘ Werk und einer der längsten Texte, der hier in den letzten 18 Jahren erschienen ist:
2007: Mika – Grace Kelly
Als dieses Blog an den Start geht, sind Gitarrenmusik im Allgemeinen und Indierock im Speziellen noch ein Ding. Bei der damals noch stattfindenden „Leserwahl“ (ein Konstrukt, das wir uns relativ offensichtlich von „Plattentests online“ abgeschaut haben), wird „A Weekend In The City“ von Bloc Party (Wann habt Ihr zuletzt an diese Band gedacht?) zum „Album des Jahres“ gewählt und „Ruby“ von Kaiser Chiefs (Oder an diese Band?!) zum „Song des Jahres“.
Auf meiner Jahresbestenliste ganz vorne ist „Tonight I Have To Leave It“ von Shout Out Louds, das ich auch ewig nicht mehr gehört habe. Und ganz versteckt, auf Platz 22: „Grace Kelly“ von Mika, ein etwas exaltierter over-the-top-Popsong mit Vaudeville- und Musical-Anleihen von einem jungen Mann, den das Adjektiv „androgyn“ begleitet. (Es waren, wie gesagt, andere Zeiten.) Ein Song, den mir „Plan B“, die etwas anspruchsvollere Musiksendung von 1Live (ich unterschied damals noch pubertär zwischen „guter“ Indie- und „schlechter“ Mainstream-Musik; andere Zeiten indeed), in die WG-Küche gebracht hat.
15 Jahre später sitze ich beim Eurovision Song Contest in Turin in der deutschen Kommentatorenkabine, zum neunten Mal als Assistent von Peter Urban, der wegen der ausklingenden COVID-19-Pandemie von Hamburg aus kommentiert. Gelandet war ich bei dieser Veranstaltung überhaupt nur, weil Stefan Niggemeier 2007 meine Kommentare in seinem Blog gelesen und mich gefragt hatte, ob ich mit ihm einen „Grand-Prix-Führer“ schreiben würde. Der Rest ist Geschichte, bzw. BILDblog, Oslog, Duslog, Bakublog, besagter Job als Kommentatoren-Assistent und mein Buch. Und dieser Mika mit seinem Song über Grace Kelly (bzw. darüber, wie man sich anpasst, um den Menschen zu gefallen) moderiert da jetzt diese Veranstaltung gemeinsam mit Laura Pausini und Alessandro Cattelan, er bringt internationalen Glamour in eine (vor allem hinter den Kulissen) eher chaotische TV-Sendung und er singt ein Medley seiner Hits.
Es ist ein seltsamer, rührender full-circle-Moment, der die größte Musikshow der Welt mit meiner alten WG-Küche und allem dazwischen kurzschließt, und in einem Anfall von Geistesgegenwart und emotionaler Überforderung schreibe ich auf jener Social-Media-Plattform, die damals noch Twitter heißt: „Es ist schön, an das Jahr 2007 erinnert zu werden. Es ist noch schöner, dass in meinem Leben heute ungefähr alles besser ist als damals.“ Oder, mit Mikas Worten: „Ca-ching!“
[Songs 2007 von damals]
2008: The Hold Steady – Constructive Summer
Die Leser*innen, die ich damals noch „Leser“ nenne, wählen „Sex On Fire“ von Kings Of Leon zum Song und „Heureka“ von Tomte zum Album des Jahres. Ich sammle die wichtigsten Nazi-Vergleiche (eine Kategorie, der damals noch ein gewisser Unterhaltungsfaktor anzuhaften scheint) und Barack-Obama-Referenzen und arbeite den Rest der Zeit fürs BILDblog.
Meine wichtigste Quelle für neue Musik ist „All Songs Considered“, ein Podcast von NPR, der auch das Vorbild für meine eigene, kurzlebige Musiksendung bei Spotify 2023/24 wird. Hier stoße ich erstmals auf The Hold Steady, eine Band aus Brooklyn (ursprünglich: Minneapolis/St. Paul), die Geschichten von Verlierern und Underdogs in hymnischen Rocksongs erzählt wie sonst nur Bruce Springsteen. Ihr Album „Stay Positive“ bringt mich durch ein Jahr, von dem ich heute so gut wie nichts mehr weiß, deshalb lasse ich mir das Symbol vom Albumcover 2011 auf meine Wade tätowieren.
Auch ihre Musik bleibt: 2009 kaufe ich mir alle Alben und höre sie rauf und runter (wie man es in einer Welt ohne Streaming eben so machte), 2010 rufe ich den „Constructive Summer“ aus: „We’re gonna build something this summer.“ Hier entstehen dann endlich Erinnerungen, die für immer bleiben werden, untermalt von „Boys And Girls In America“, „Stay Positive“ und dem damals neuen Nachfolge-Album „Heaven Is Whenever“.
[Songs 2008 von damals]
2009: Kilians – Hometown
Nach über fünf Jahren im Studentenwohnheim muss ich mir mal langsam eine eigene Wohnung suchen und ich überlege: In Bochum bleiben oder nach Hamburg ziehen? Es ist ein Jahr der großen Gefühle zwischen Welt erobern wollen und zuhause einsperren, begleitet von der ganz großen, unerfüllten Liebe.
Meine Freunde von den Kilians (Bruder, Demo-CD, Thees Uhlmann, Tomte-Tour — you know the story!) veröffentlichen im April ihr zweites Album „They Are Calling Your Name“ und spielen aus diesem Anlass ein Konzert auf dem Hans-Böckler-Platz in Dinslaken, jener Stadt, in der wir alle – die Kilians, ich und die ganz große, unerfüllte Liebe – aufgewachsen waren. Ihr Song „Hometown“ ist das Angebot einer Hymne.
Die Band löst sich 2013 auf, da wird der Hans-Böckler-Platz gerade mit einem Einkaufszentrum überbaut. Wenn man heute „Dinslaken“ sagt, reagieren nicht mehr viele Menschen mit „Aaaah, die Kilians!“ (aber – und das wird die Bürgermeisterin freuen – auch nicht mehr mit „Aaaah, der Wendler!“ oder „Aaaah, die Salafisten!“). Die Stadt hat sogar die Emschermündung verloren. Aber Erinnerungen und Musik werden ja immer bleiben.
(Ich entscheide mich 2009 übrigens für Bochum. My hometown.)
2010: Lena – Satellite
„Irgendwann musst Du Dir das mal vor Ort anschauen“, hatte Stefan Niggemeier 2008 über den Eurovision Song Contest (damals und immer schon: „Eurovision Song Contest“) gesagt, aber weil Moskau schon damals kein Ort ist, an dem man gerne sein möchte, verschieben wir unser Projekt auf das Folgejahr und nach Oslo. Womit wir nicht rechnen: dass in Deutschland ein regelrechter ESC-Hype um eine 18-jährige Abiturientin aus Hannover ausbricht und die diese merkwürdige Quatsch-Veranstaltung tatsächlich gewinnt. (Also: In der ersten Folge des Oslog wette ich natürlich genau das, allerdings ohne auch nur einen anderen Wettbewerbsbeitrag zu kennen.)
Als altes Theater-Kind zieht mich die jährliche Leistungsschau der Bühnentechnik-Industrie sofort in ihren Bann und auch musikalisch ist das alles gar nicht mehr so schlimm, wenn man es nur oft genug gehört hat. Aber trotz der einschneidenden, im Nachhinein lebenswegweisenden Erfahrung in Oslo traue ich mich nicht, „Satellite“ auf meine Jahresbestenliste zu packen. Da sollen auch weiter nur Indie-kredibele Sachen zu finden zu finden sein (und so ignoriere ich offenbar auch das tolle Take-That-mit-Robbie-Album „Progress“ komplett). Das passt zu einem Jahr, in dem ich nicht gerade dadurch auffalle, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, sondern mich lieber vom Großstadt‑, vor allem aber Nachtleben rund um meine neue Wohnung in der Innenstadt mitreißen lasse und als neuer BILDblog-Chef in Talkshows gehe und zu Journalistenkongressen ins Ausland fliege. („It’s physics / There’s no escape.“)
Hier also späte Genugtuung für einen Song und ein Ereignis, ohne die ich heute nicht da wäre, wo ich bin, und ohne die der ESC in Deutschland immer noch als „Schlager-Grand-Prix“ firmieren würde, bei dem man ohnehin nichts reißen kann.
[Songs 2010 von damals]
2011: Thees Uhlmann – 17 Worte
Mein Kumpel Thees Uhlmann ist im Jahr 2011 wie so oft weiter als ich: Vater geworden, Beziehung zerbrochen, dabei, das Glück im Kleinen zu suchen. Ich bin vier bis fünf Abende die Woche im Freibeuter im Bochumer Bermuda3eck und schreibe nebenher das BILDblog voll. Deswegen ignoriere ich Thees‘ selbstbetiteltes Solo-Debüt damals auch rüpelig bei den „Alben des Jahres“ (und lobe lieber das nächste egale Coldplay-Album), obwohl ich es wirklich oft höre.
Aber diese Liste hier ist auch eine Chance auf Wiedergutmachung, denn sechs Jahre später stehe ich beim GHvC-Geburtstag in Hamburg im Nieselregen: Vater geworden, Beziehung zerbrochen, dabei, das Glück im Kleinen zu suchen. Also völlig andere Prioritäten und Prinzipien: „Meine Wahrheit in 17 Worten: / Ich hab ein Kind zu erziehen / Dir einen Brief zu schreiben / Und ein Fußball-Team zu supporten.“ (Bei Erscheinen des Albums hatte ich Thees eine SMS geschrieben, dass das nur 16 Worte wären, weil man „Fußballteam“ zusammenschreibe. Seine Antwort kam natürlich prompt: „Fußball Team!“)
2021 sehe ich Thees Uhlmann und Band live im Burgtheater in Dinslaken (weil: natürlich). Es ist mein erster Konzertbesuch seit anderthalb Jahren, mein Sohn ist an meiner Seite, meine Eltern irgendwo in meinem Rücken, der VfL Bochum ist aufgestiegen. Weite Teile der Öffentlichkeit sind während der immer noch anhaltenden Pandemie dem Wahnsinn anheimgefallen, aber als Thees „17 Worte“ spielt, macht für mich alles Sinn: Wir singen, um uns zu erinnern.
[Songs 2011 von damals]
2012: Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe
Dieser bekloppte Eurovision Song Contest hat mich nach Aserbaidschan verschlagen. Ich sitze in Baku im Hotelzimmer, gucke russisches Musikfernsehen und sehe dieses Video. Als der Song zu Ende ist, zappe ich weiter und sehe das gleiche Video auf dem nächsten Kanal direkt noch mal von vorn. „Komische Russen“, denke ich, will den Song bei Facebook posten und stelle fest, dass ich mit „Call Me Maybe“ einen internationalen Hit verpasst habe.
Wahrscheinlich ist es dieser Moment, in dem ich dieses elitär-pubertäre Musik-nur-gut-finden-wenn-sie-sonst-keiner-hört-Dingen aufgebe und endlich frei bin, Dinge gut zu finden, nur weil ich sie gut finde. Um Dinge auch öffentlich gut zu finden (jedenfalls meistens), starten Tom Thelen und ich im Blog unseren Kino-Podcast „Cinema And Beer“.
„Before you came into my life / I missed you so bad“ ist immer noch eine der besten Zeilen, die je über romantische Liebe geschrieben wurde — und das waren ja nun wirklich nicht wenige. Carly Rae Jepsen in der Kölner Essigfabrik ist im Februar 2020 mein letztes Konzert vor dem Lockdown (ist es nicht Magie, wie hier alles ineinandergreift?!) und die fröhliche Stimmung dieses durchaus ESC-tauglichen Publikums trägt mich durch die ersten, dunklen Monate der Isolation.
[Songs 2012 von damals]
2013: Daft Punk feat. Pharrell Williams & Nile Rogers – Get Lucky
Ich sitze in einem Auto, das mich vom Hotel zur Malmö Arena bringt, neben mir: ESC-Kommentatorenlegende Peter Urban. Als wäre das nicht schon absurd genug, wippt dieser 65-jährige Mann zur Musik aus dem Autoradio mit: „Get Lucky“ von Daft Punk, Pharrell Williams und Nile Rogers. Natürlich kennt er das, denn es ist ja ein internationaler Superhit, dem man nur schwer entkommen kann, und Peter würde auch jede Menge deutlich obskurere Songs mitsingen, die in den letzten ca. 50 Jahren erschienen sind, aber irgendwie überrascht es mich in diesem Moment doch, denn Daft Punk, das sind doch die von Viva 2 (wo sie jetzt zugegebenermaßen auch nicht zwingend zur Avantgarde gezählt hatten).
Die Dominosteine, von denen dieses Blog der erste war, haben mich hierher gebracht, ins Epizentrum des Entertainments. Nur einen Monat später sollen sie mich zum Late-Night-Meinungsmagazin „Tagesschaum“ mit Friedrich Küppersbusch führen und von dort zu unserem gemeinsamen Podcast „Lucky & Fred“. Das Leben meint es gut mit mir, beruflich wie privat.
[Songs 2013 von damals]
2014: Andrew McMahon In The Wilderness – High Dive
Ich hätte immer gesagt, dass das Jahr 2014 hier im Blog gar nicht stattgefunden hat, aber es gibt doch einige Einträge aus dieser Zeit — die meisten als Teil der kurzlebigen Serie „Song des Tages“. Ich erinnere mich an nichts, weil ich zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt bin: Umzug, neue Jobs, Hochzeit planen und absagen, Vater werden, irgendwie versuchen, meine Beziehung zu retten. Alles Dinge, auf die einen Popkultur nur unzureichend vorbereitet; alles Dinge, die für Popkultur wenig Zeit lassen.
Das erste neue Album, das ich mit meinem Sohn höre, ist das Solodebüt von Andrew McMahon, der mich mit seinen Bands Something Corporate und Jack’s Mannequin jetzt auch schon mehr als zehn Jahre begleitet. Er ist auch gerade Papa geworden, so kann ich die Verarbeitung meiner Lebenswirklichkeit wieder mal auf ihn abwälzen und einfach seine Songs hören. Obwohl wir doch noch jung sind, ist da viel Nostalgie in seinen Texten wie „High Dive“, aber Facebook ersetzt Kneipenabende mit Freund*innen ja auch nur bedingt.
2015: Ben Folds feat. yMusic – Phone In A Pool
2015 ist dann tatsächlich das Jahr, das nicht war, denn ich schreibe sensationelle sieben Blogeinträge, von denen die meisten ursprünglich Facebook-Posts waren. Offenbar schaffe ich es immerhin ein paar Mal ins Kino. (Ach, „The Force Awakens“ ist von 2015?!) Ich kann mich an nichts erinnern und es geht mir wirklich nicht gut.
Ein bisschen Trost kommt von meinem ewigen Helden Ben Folds, der gerade die vierte Scheidung (von inzwischen fünf) hinter sich hat und mit dem Kammermusik-Ensemble yMusic ein Album einspielt, auf dem auch sein erstes Klavierkonzert zu hören ist. (Wir gehen alle unterschiedlich mit Lebenskrisen um.) In „Phone In A Pool“ berichtet er: „Found the love of my life again / Y’all knows what I means / And I’ll be back on the sofa in a puddle in a couple of weeks“. Bei all dem Elend ist es schön, dass jemand, der mich mein halbes Leben lang begleitet, immer noch Songs schreiben kann, die so gut zu meinem eigenen Leben passen. Natürlich gibt es am Ende des Jahres keine Listen — ich hab ja eh viel zu wenig Musik gehört und wann hätte ich die denn noch schreiben sollen?
2016: Weezer – California Kids
Neuanfang in einer eigenen Wohnung und das Vorhaben, das Blog jetzt aber wirklich wieder zu befeuern. Da passt es ganz gut, dass Benjamin von Stuckrad-Barre, dessentwegen ich als Teenager mit dem Schreiben angefangen hatte, ein neues Buch veröffentlicht, ungefähr zeitgleich mit dem neuen Album der von uns hoch verehrten Pet Shop Boys und dem von Weezer. Alle drei Acts eint, dass ihr Schaffen nicht zu jedem Zeitpunkt ihrer Karriere den Ansprüchen des eigenen Publikums genügte, aber jetzt sind sie wieder voll da.
Also eigentlich eine gute Gelegenheit, darüber zu schreiben und über andere Dinge, die mir Freude bereiten, aber das Internet ist damals im wesentlichen Facebook und dort sind wir alle damit beschäftigt, mit irgendwelchen AfD-Anhängern zu diskutieren, die irgendwo etwas Dummes kommentiert haben. Um diesem ganzen Irrsinn zu entfliehen, schreibe ich nicht etwa wieder mehr ins Blog, sondern starte meinen eigenen Newsletter. Da macht das Schreiben immerhin auch Spaß.
Weezer, jedenfalls, kenne ich seit mehr als 20 Jahren, als das Video zu „Buddy Holly“ bei „Hit-Clip“ lief und auf der Windows-95-CD-Rom enthalten war. Jetzt veröffentlichen sie schon das vierte Album namens „Weezer“ (nach dem blauen, dem grünen und dem roten Album jetzt ganz Beatles-mäßig das weiße), das meinen Sohn und mich auf vielen Ausflügen zum Kemnader See begleitet und ihr bestes seit Jahrzehnten ist. Der opening cut „California Kids“ handelt von den glücklichen jungen Menschen aus dem Golden State, die einem das Leben retten. Ich nenne Kalifornien gerne „my home away from home“, was vielleicht etwas prätentiös ist, aber ich hab da halt Familie und es ist auch der einzige Ort außerhalb des Ruhrgebiets, an dem ich je so viel Zeit am Stück verbracht habe. Der Staat bleibt auch nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten das (natürlich eher theoretische) Ideal, das ich bewundere, genauso wie ich Menschen auch lieber aus der Ferne toll finde — California Kids halt.
2017: kettcar – Ankunftshalle
Als dieses Blog an den Start geht, haben kettcar bereits zwei Alben veröffentlicht: ihr Debüt „Du und wieviel von Deinen Freunden“, ein instant classic, und – begleitet von Fernsehauftritten und ganzseitigen Zeitungsartikeln – den Nachfolger „Von Spatzen und Tauben, Dächern und Händen“. Trotzdem schreibe ich in all den Jahren relativ wenige Texte über diese Band, die mir so wichtig ist. Vielleicht weil ich denke, dass das eh klar ist.
2017 liegt das letzte (eher okaye) kettcar-Album fünf Jahre zurück, Marcus Wiebusch hat in der Zwischenzeit ein (ziemlich gutes) Soloalbum veröffentlicht, aber plötzlich ist die Band wieder ein Machtblock mitten in Europa: Ihre stets klare politische Haltung, die Jahre vorher noch ein bisschen folkloristisch anmutete, ist inzwischen notwendig, aber neben Songs wie „Sommer ’89“, „Wagenburg“ und „Mannschaftsaufstellung“ gibt es auch jene, die sich anfühlen wie Polaroids (oder Insta-Posts) aus dem Alltag. „Die Straßen unseres Viertels“ ersetzt eine ganze Fernsehserie über das Familienleben in Hipster-Vierteln, ohne sich für eine Sekunde Harald-Schmidt-mäßig über Hafermilch lustig zu machen; „Trostbrücke Süd“ ist ein Kameraschwenk durch einen Linienbus voller Menschen, die aufstehen, atmen, sich anziehen und hingehen, und „Ankunftshalle“ der Blog-Eintrag, Newsletter oder Song, den ich immer hatte schreiben wollen: ein Loblied auf die heilende Kraft von Flughafen-Ankunftshallen, wo Menschen sich nach langer Zeit der Trennung wieder in die Arme fallen.
Als kettcar und Thees Uhlmann im August im Hamburger Nieselregen 15 Jahre Grand Hotel van Cleef feiern, ist wenige Tage zuvor meine Oma gestorben, die hier von Anfang an mitgelesen hatte. Ende Dezember liegt mein Opa im Sterben und ich fahre mit meinem Sohn zum Düsseldorfer Flughafen, Menschen in der Ankunftshalle gucken.
[Songs des Jahres 2017 damals]
2018: Rae Morris – Do It
Hatte ich oben – also vor ca. 18.000 Zeichen – nicht noch geschrieben, dass in dieser Liste explizit nicht die jeweiligen Songs des Jahres auftauchen sollen? Well: We make up the rules as we go along!
Rae Morris hat sich ihre Sonderrolle hier im Blog verdient: Weil ich mich 2012 instantly in ihren Song „Don’t Go“ aus dem (eigentlichen) Serienfinale von „Skins“ (der einzigen Fernsehserie neben „Die Brücke“, von der ich alle Folgen gesehen habe) verliebt habe; weil sie der erste (und bis heute einzige) Act in der Geschichte dieses Blogs ist, der in einem Jahr (2018) meinen persönlichen „Song des Jahres“ und mein „Album des Jahres“ veröffentlicht hat (das haben Tomte 2006 zwar auch geschafft, aber halt sechs Wochen, bevor dieses Blog an den Start ging, also zählt das nur an ungeraden Wochentagen ohne Neumond); weil sie der erste (und bis heute einzige) Act ist, der zwei Mal meinen persönlichen Song des Jahres (2012 und 2018) geschrieben hat.
Irgendwie alles trockener Statistik-Kram angesichts eines Songs, der davon handelt, auf die Zweifel zu pfeifen und sich kopfüber in die Liebe zu stürzen. Rae Morris singt das über ihren musikalischen Partner und heutigen Ehemann Fryars und sie macht das so toll, dass ich mit ihr an die große Liebe glauben will, die sich anfühlt wie Feuerwerk aussieht. Doch meine Versuche, „Do It“ in „Joko Winterscheidts Druckerzeugnis“ zum Sommerhit des Jahres zu pushen, scheitern und Menschen wie ich bleiben besser allein.
Aber, so denke ich heute, eigentlich ist dieses Blog hier ja auch nichts anderes als die Umsetzung des Gedankens „We could just do it“: Gestartet als „die Online-Zeitung, die wir gerne lesen würden“ (puh!), konnte ich mich hier an der Tastatur und vor der Kamera austoben, ausprobieren und daran wachsen, um dann für Zeitungen und Fernsehsendungen zu arbeiten, die ich früher nur rezipiert hatte. Wenn man aus 18 Jahren Coffee And TV unbedingt irgendetwas lernen will, dann, dass Selbstermächtigung manchmal (es gehört ja auch bei mir sicherlich einiges an Glück dazu) wirklich funktionieren kann.
[Songs des Jahres 2018 damals]
2019: LOKI – The Girl With No Eyes
Für die, die hier ernsthaft Buch führen (also: für mich), mag es etwas überraschend sein, dass ein Song, der auf Platz 59 einer Jahresbestenliste stand, ein Jahr repräsentieren soll. Nun: Erstens können wir uns glaub ich darauf einigen, dass es eh schon ein ganz kleines bisschen wahnsinnig ist, einen „Platz 59“ auf einer persönlichen Bestenliste zu haben; zweitens habe ich erst bei der Durchsicht meiner diversen Listen, Einträge und Playlists festgestellt, dass ich tatsächlich schon mal Musik von LOKI gehört haben muss, bevor ich sie letztes Jahr beim Festival Sounds Like Sugar in Herne gesehen habe und so begeistert war, dass ich sie beim Bochum Total direkt wieder sehen musste.
Damit steht „The Girl With No Eyes“, dessen Bon-Iver-Haftigkeit mich schon 2019 überzeugt haben muss, nämlich für etwas anderes: Für das wilde Überangebot an Werken (oder: „Content“, wie die Arschlöcher sagen, die in ihrem Leben nicht einen einzelnen genuinen Gedanken hatten), aus dem wir theoretisch wählen können, das aber auch das Risiko birgt, alles beliebig und egal zu machen. Dass es etwas anderes ist, tagelang in physischen Läden nach einer CD zu fahnden und sie dann endlich zu finden, als einfach alles immer sofort (terms and conditions apply) zur Verfügung zu haben, hab ich schon 2016 aufgeschrieben. Es ist seitdem nicht weniger geworden. Wenn ich mich nicht mehr an irgendwelche Acts erinnern kann (natürlich auch, weil ihre Namen nur noch über Bildschirme flimmern und nicht ausgedruckt vor mir liegen, was meinem Gehirn immerhin ein bisschen helfen würde), ist es alles ein bisschen viel.
Ich selbst trage fröhlich zum Überangebot bei: Mit Friedrich Küppersbusch stehe ich jetzt regelmäßig auf Bühnen in Dortmund und Berlin, um „Lucky & Fred“ vor Publikum aufzuzeichnen. Da kommt das Theater-Kind von früher wieder zum Vorschein, Applaus ist immer noch die stärkste Währung. Weil Likes dagegen abstinken und dort eh nichts mehr los ist, lösche ich am Silvesterabend meinen Facebook-Account. Im Nachhinein möchte ich sagen: Ich habe schon dümmere Dinge zu einem schlechteren Zeitpunkt gemacht.
[Songs des Jahres 2019 damals]
2020: Taylor Swift – Epiphany
Alles beginnt so schön mit weiteren Live-Auftritten und Konzertbesuchen bei kettcar, Ider und Carly Rae Jepsen. Und dann endet alles: Konzerte, Kindergarten, Bundesliga, sogar der Eurovision Song Contest wird erstmals abgesagt. „Wegen Corona“ wird ein sogenanntes geflügeltes Wort, was auch irgendwie zu den verdammten Flughunden auf dem Nassmarkt von Wuhan passt, die uns die ganze Scheiße (mutmaßlich) eingebrockt haben.
Popkultur-Freund*innen vergleichen die Straßen mit jenen aus dem Zombiefilm „28 Days Later“ und wir lernen die Wohnzimmer von Kolleg*innen und Rockstars kennen, die von dort aus Mini-Konzerte in die Welt streamen (die Rockstars, nicht die Kolleg*innen). Die Leute erscheinen all das mit erstaunlichem Gleichmut zu ertragen, aber dieses Bild bekommt – um eine weitere Phrase zu vermeiden – schnell Risse: Als sich im April eine Frau, die vor einem Café warten muss, um Kuchen zum Mitnehmen zu kaufen, über die „Gesundheitsdiktatur“ beschwert, bin ich viel zu überrascht und schockiert, ihr vorzuschlagen, dass wir gerne gemeinsam einen Bekannten von mir, der Arzt in Padua ist, anrufen könnten und sie ja mal mit dem sprechen könne, wenn er nicht gerade dabei ist, um Leben zu kämpfen.
Es ist ein Vorgeschmack auf das, was kommt: Weil man sich jetzt nirgendwo mehr in die Augen gucken kann, vergessen nahezu alle, dass sie online mit anderen Menschen diskutieren. Manche von uns nutzen die viele freie Zeit, um sich über Rassismus fortzubilden, andere, um sich zu radikalisieren. Ich schreibe viel in meinen Newsletter und wenig ins Blog, starte aber zusammen mit Sue Reindke immerhin einen neuen Podcast namens „Bist Du noch wach?“
In all das hinein veröffentlicht Taylor Swift, die nach einer abgesagten Welt-Tournee auch zu viel Freizeit hat, ein Album, das sie in den ersten Monaten des Lockdowns mit Aaron Dessner von The National aufgenommen hat, remote. „Folklore“ wird zum Soundtrack des ersten Corona-Sommers und überzeugt selbst jene, die ihrer Musik bisher kritisch gegenübergestanden hatten. Mit „Evermore“ erscheint ein paar Monate später noch so ein großer Wurf. Nach dem großartigen „1989“ von 2014 hab ich endlich die nächste era, in der ich mich einrichten kann. Es ist der Soundtrack zu sehr ausgiebigen Spaziergängen durch die verschiedenen Nachbarschaften hier in Bochum. Und mittendrin ein Song über Soldaten und Menschen im Gesundheitswesen, über das Sterben in Einsamkeit und über das Weitermachen der Überlebenden: „Epiphany“. „Someone’s daughter, someone’s mother / Holds your hand through plastic now“ sind Zeilen, die mir auf ewig die Tränen in die Augen treiben und einen Klos in den Hals drücken werden. Die gute Nachricht: Meine Omi, die mit 94 noch allein in ihrem viel zu großen Haus wohnt, überlebt all das ohne Ansteckung. Das ist nicht ihr Song.
[Songs des Jahres 2020 damals]
2021: Meet Me @ The Altar – Never Gonna Change
2021 ist die etwas öde Fortsetzung des Seuchenjahres, aber als Farce: Hashtag Osterruhe. Die Amtszeit von Donald Trump endet, die von Angela Merkel auch. In Rotterdam, wo der ESC unter Pandemie-Bedingungen stattfindet, lautet der schon 2019 ersonnene Slogan passenderweise „Open Up“. Den Sommer verbringe ich damit, mein Buch über den Song Contest zu schreiben, an Omis Geburtstag und an Weihnachten sind wir wieder alle vereint.
In Aachen treffe ich einen meiner allergrößten Helden: Michael Stipe von R.E.M. Er ist so bezaubernd, wie ich erhofft hatte, und gibt mir das Gefühl, als sei ich der allererste Mensch, der „You’ve changed my life“ zu ihm sagt. Der VfL Bochum steigt nach elf Jahren wieder in die Bundesliga auf. Nature is healing.
Meine aktuelle Lieblingsband heißt Meet Me @ The Altar, queer Women of Color aus den USA, die Pop-Punk zwischen Avril Lavigne, Paramore und Blink-182 machen. Zum ersten Mal hören tue ich von ihnen bei – natürlich – „All Songs Considered“ auf – natürlich – einem meiner langen Spaziergänge, in Erinnerung bleiben mir ihre EP „Model Citizen“ und der Song „Never Gonna Change“ aber vor allem als Soundtrack zu den ersten Besuchen im Fitnessstudio, die jetzt wieder möglich sind.
[Songs des Jahres 2021 von damals]
2022: Maro – Saudade, Saudade
Am Ende wird es das Jahr gewesen sein, das ich so lang gefürchtet hatte: das, in dem meine Omi stirbt. Es werden lange vier Monate des Abschieds, die ihren Kindern alles abverlangen, aber es eine Zeit des bewussten, liebevollen Abschieds und der Liebe in ihrer reinsten Form.
All das ahne ich noch nicht, als ich beim ESC in Turin sitze und völlig gebannt (das englische Wort mesmerized kennen wir im Deutschen leider nicht, obwohl es doch auf einen deutschen Arzt zurückgeht) dem Auftritt der portugiesischen Künstlerin folge, die das spezifisch portugiesische Gefühl saudade besingt, das mit „vermissen“ nur unzureichend übersetzt werden kann und das sie nach dem Tod ihres geliebten Großvaters empfindet. „Saudade, Saudade“ erreicht am Ende einen tollen 9. Platz, Deutschland hat auch teilgenommen. Allerspätestens hier in Turin ist der ESC nicht mehr die leicht trashige Quatsch-Veranstaltung, als die er noch galt, als Stefan und ich 2007 erstmalig darüber gebloggt haben. Er ist ein echtes Musikfestival, bei dem man Genres und Acts vorgestellt bekommt, auf die man sonst vielleicht nie gestoßen wäre. Wer hier noch alles doof findet, mag wahrscheinlich einfach keine Musik.
Mein Buch über diese Veranstaltung erscheint quasi zeitgleich mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, was mir eine ordentlich Portion der Freude raubt. Als ich den Release trotzdem mit Freund*innen in meiner Stammkneipe feiere, stecke ich mich (endlich) mit COVID-19 an und bin immer noch reichlich außer Atem, als ich das Buch in einer kleinen großen Liveshow in der Zeche Carl in Essen vorstelle. Irgendwie schaffe ich es sogar, in diesem Jahr noch einen Podcast zu produzieren: die Talksendung „Woher kennen wir uns?“
[Songs des Jahres 2022 damals]
2023: Foo Fighters – Rescued
Omi und Taylor Hawkins sind im selben Jahr gestorben, was insofern besonders tragisch ist, als der Schlagzeuger der Foo Fighters 46 Jahre jünger gewesen war. Dave Grohl hatte zum dritten Mal einen seiner besten Freunde verloren, Monate später seine Mutter. Ob das der Beginn einer etwas verspäteten midlife-crisis war, in deren Verlauf jene Tochter entstand, die „außerhalb meiner Ehe“ geboren wurde, wie er auf Instagram schrieb, vermag ich nicht zu beurteilen — es war zumindest der Auslöser, „But Here We Are“ aufzunehmen, das beste Foo-Fighters-Album seit fast 25 Jahren, auf dem er wieder einmal Trauer in Wut verwandelt und umgekehrt.
„Rescued“ ist einer der ersten Songs, den ich in meiner kleinen Musiksendung spiele, die ich in einem Anfall besonderer Geistesgegenwart auch „Coffee And TV“ genannt habe. Sie ist das, worauf ich Jahrzehnte lang gewartet hatte: die Möglichkeit, Songs in einem Podcast zu spielen, ohne in einem kostspieligen Bürokratiegewitter namens „GEMA“ unterzugehen. Das Ergebnis kann man zwar nur beim finsteren Tech-Konzern Spotify hören, aber entscheidender ist für mich eh, sowas überhaupt machen zu können. Aber wie so oft mit den schönen Dingen im Internet: Nur ein Jahr später zieht Spotify den Stecker und schafft die Möglichkeit, solche Musiksendungen zu bauen, direkt wieder ab.
„But Here We Are“ wird auch 2024 wieder für mich da sein: Als meine geliebte Tante Dörte stirbt, eine großartige Grundschullehrerin, höre ich den Song, den Dave Grohl für seine verstorbene Mutter Virginia geschrieben hat, die ebenfalls Lehrerin gewesen war: „The Teacher“.
2024: Ezra Collective feat. Yazmin Lacey – God Gave Me Feet For Dancing
Das ist mir in all den Jahren auch noch nicht passiert, dass ich – trotz aller Playlisten, Notizen-Apps und Zettel – beim Zusammenstellen der „Alben“ oder „Acts des Jahres“ ein Album bzw. einen Act komplett vergesse. Ob’s am Alter liegt oder dem schon erwähnten Überangebot?
Immerhin habe ich hier die Gelegenheit, den Fehler schnell halbwegs wettzumachen: „God Gave Me Feet For Dancing“ von Ezra Collective und Yazmin Lacey. Ezra Collective sind eine Jazz-Fusion-Band aus London, die Elemente aus Afrobeat, Calypso, Reggae, Hip-Hop, Soul und Jazz verbinden und deren Songs bei BBC Radio 6 Music, meiner aktuellen Hauptquelle für neue Musik, rauf und runter läuft. Es ist diese Musik, die ich mit dem leichtfüßigen Sommer 2024 verbinde, als wir alle denken, dass Kamala Harris US-Präsidentin werden wird, und die Olympischen Spiele in Paris ein Gefühl von Hoffnung, Zuversicht und Gemeinschaft vermitteln, das wir so lange vermisst hatten. Sich ein paar Monate später über die eigene vermeintliche Naivität lustig zu machen, wäre aber auch zynisch.
[Songs des Jahres 2024 von „damals“]
Epilog
„Am Ende wird alles okay sein — und wenn es nicht okay ist, ist es nicht das Ende“, hat der brasilianische Autor Fernando Sabino geschrieben und Weezer nannten ihr 2015er Album „Everything Will Be Alright In The End“. „Schwimm für die Songs, die noch geschrieben werden“, hat Marcus Wiebusch von kettcar auf seinem Soloalbum gesungen — und dabei Andrew McMahon referenziert. Alles hängt immer mit allem zusammen.
Social Media ist, spätestens seit sich die Tech-Oligarchen um Donald Trump scharen, ein dumpster fire, das unsere Seelen und Gehirne verzehrt. Doch das hier sind nur die ersten 18 Jahre und die ersten 18 Songs. Coffee And TV ist mein Zuhause und ich plane zu bleiben, mein Freund.
Denn wie sang einst Graham Coxon in jenem Blur-Song, dessen Titel wir uns damals einfach gemopst haben?
Take me away from this big bad world
And agree to marry me
So we can start over again
(Auf das mit dem Heiraten würde ich nach den oben erwähnten Erfahrungen allerdings gerne verzichten.)